Bob Dylan ist einer der größten amerikanischen Lyriker des 20. Jahrhunderts. Lyrik ist klingende Sprache. Dylan ist ein Mann durch den die Muse spricht. Dylan ist Barde, Troubadour, Intellektueller, Dichter und auch Dieb. Also kurz gesagt ein Sprachkünstler, dessen geschriebenes Wort durch das gesungene bekannt wurde. Der Nobelpreisträger für Literatur 2016 ist einer Tradition verpflichtet, die sich über Allen Ginsberg, Dylan Thomas und Herman Melville zurückverfolgen lässt bis zu François Villon, William Shakespeare, Cecco Angiolieri, Dante, Vergil und Homer (ein Volkssänger!). Wer seine Auszeichnung mit Stirnrunzeln zur Kenntnis nimmt, dem (oder der) sei nicht vorgeworfen – zumindest nicht von mir –, dass es an Kenntnis von Dichtung mangelt, aber dass ein großer Nachholbedarf an Dylans Werk besteht.
Wer Dylans Chronicles aufschlägt, wird unwiderstehlich in eine unwiederbringlich vergangene Welt gesogen. Eine Welt der Boxer, der verlassenen Gaslicht-Alleen, der Honky-Tonk-Klaviere, der kalten New Yorker Winter. Es ist eine John-Steinbeck-Welt, gesehen mit den Augen eines Holden Caulfield. Doch auch wenn der Erzählton ähnlich ist, die Kadenzen sind eine andere. Weniger zaghaft, mehr auf den Punkt, genauso ehrlich wie Salingers Held, aber die Stimme ist schärfer, unberechenbarer, die von Dylan eben – wie ein Dolch unterm Mantelaufschlag. Dylans Seele ist gefährlich, oder gefährdet, durch seine Entscheidung zum Leben am Limit, durch seine Lebensgeschwindigkeit („Ich sprach schnell, dachte schnell, ging schnell und ich sang meine Songs schnell.“), durch seinen Willen, sich als Singer/Songwriter einen Namen und seinem Vorbild Woodie Guthrie alle Ehre zu machen.
Chronicles Vol. 1 ist auch ein Buch über Bücher. Dylan zieht sich im Kapitel The Lost Land lange Zeit auf das Sofa in der Bibliothek seines Quartiergebers Ray zurück und verschwindet in den Werken von Faulkner, Clausewitz, Gogol, Maupassant, Hugo, Dickens und Balzac („Ich mochte seine Beobachtung, dass blanker Materialismus ein sicheres Rezept für den Wahnsinn ist.“), gräbt sich durch die Gedichtbände von Byron, Shelley, Longfellow und Poe; er spiegelt seine Erfahrungen als Neuling in der großen Stadt Manhattan über Literatur.
Und über Musik: Der junge Bob studiert die gesamte Fülle des Great American Songbook, von Hank Williams bis Roy Orbison, von Buddy Holly bis Sinatra und von Leadbelly bis Harry Belafonte („Harry strahlte diese Größe aus, von der du hoffst, dass sie auf dich abfärbt.“).
Diese Lehr- und Wanderjahre in New York weisen bereits voraus – auf den enigmatischen, kristallin-vergeistigten Radio Host mit dem enzyklopädischen Wissen, der Dylan nun geworden ist. Chronicles in seiner Gesamtheit ist ein Vexierspiegel der persönlichen Entwicklung, ein Reigen von Momenten aus vier Jahrzehnten in Dylans Karriere. Bob Dylan offenbart hier seine Seele, eine feine Seele: durchlässig, hungrig und verletzlich. Seine Autobiografie ist ein dermaßen dichtes, in seinem Slang und seinem Rhythmus euphonisches, kunstvoll mit Querverweisen angereichertes und dabei so persönliches und liebenswertes Buch, dass Dylan alleine dafür den Literaturnobelpreis erhalten hätte sollen.
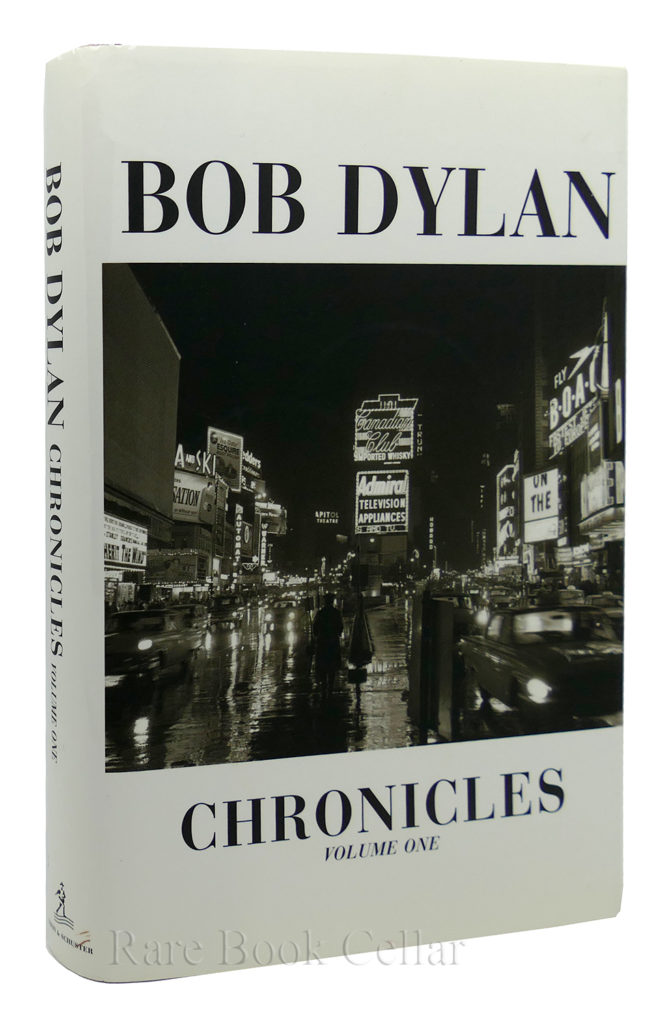
Simon & Schuster, 2005; 303 S., €25,83
Wer einfach Dylans Stimme oder seine oft zweifelhafte Gefolgschaft nicht mag oder die Bürgerrechtsbewegung und Jugendrevolte der 1960er nicht verstehen will, disqualifiziert sich in der Debatte klarerweise von selbst, genauso wie jene, die Dylan als „Popmusiker“ wie Madonna, Lady Gaga oder Prince missverstehen – und deren gibt es besonders im deutschsprachigen Feuilleton viele. Längst sollte Klarheit darüber bestehen, dass „Popmusik“ literarisch ernsthafte Lyriker wie Leonard Cohen, Joni Mitchell, Chuck Berry (!), Paul Simon, John Lennon, Mick Jagger, Marianne Faithfull, Patti Smith, Sting, Morrissey, Nas, André 3000 oder PJ Harvey hervorgebracht hat. Unter den deutschsprachigen Pop-Poeten und Liedermachern (ich mag den Ausdruck wegen seinem inhärenten Hinweis auf das Handwerkliche, Gekonnte) gibt es ebenfalls eine ganze Reihe von Namen, die als ernstzunehmende Lyriker hervorzuheben sind: Herbert Grönemeyer, Konstantin Wecker, Rio Reiser, Herwig Mitteregger, Udo Lindenberg, Georg Kreisler, Helmut Qualtinger, Georg Danzer, Ludwig Hirsch, André Heller, Erika Pluhar, Wolfgang Ambros (der übrigens einiges an Dylanschem Liedgut adäquat ins Österreichische übertragen hat), der Nino aus Wien, Judith Holofernes, Sven Regener, Max Herre, Clueso und natürlich die Fantastischen Vier. Für die Franzosen seien Gainsbourg, Brel, Aznavour, Piaf und MC Solaar in die Argumentation geführt, die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
xx

xx
Kritiker der Entscheidung möchten auch Dylans Spracharbeit mit anderen bisherigen Literaturnobelpreisträgern abwägen. Da wogt – ganz abgesehen vom Inhalt – der Anspruch an das sprachliche Niveau der Preisträger auf und ab wie die stürmische Nordsee.
Hier sind mal meine sieben Gründe, warum die Vergabe dieses hohen Literaturpreises absolut gerechtfertigt ist:
- Alleine die Texte von Visions of Johanna und Tangled Up In Blue
- Seine gesammelten Songtexte als Buch
- Dylans Memoiren (Chronicles)
- Der Gedichtband Tarantula
- Seine Lecture über Literatur und Songtradition
- Die Befreiung des Geistes von Konventionen und Konformität
- Tausende akademische Arbeiten, die sich mit ihm beschäftigen
Nachgereicht sei auch ein Zitat von einem, der wohl sämtliche Sagen und Liederzyklen der Menschheit auswendig kennt – der österreichische Erzähler Michael Köhlmeier (in einem Interview mit Karl Fluch vom Standard, als Dylan erst im Gespräch für den Nobelpreis war): „Das Komitee hat bisher die Chance vertan, die Popkultur als originäre Literatur des 20. Jahrhunderts wahrzunehmen. Diese Songkultur ist ja eine ganz eigene Gattung. Wenn sie einmal draufkommen, das nachzuholen, ist Bob Dylan der, der als Anwärter an erster Stelle steht. Wenn er’s nicht kriegt, ist es auch kein Schaden. Aber dass über ihn diese ganze Gattung geehrt würde, da dürfte sich das Komitee nicht zu vornehm dafür sein.“
Und der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie bei seiner Laudatio zur Verleihung des Awards für Song Lyrics of Literary Excellence des PEN New England und der John F. Kennedy Presidential Library an Chuck Berry und Leonard Cohen, im Jahr 2012: „Es ist schon lange mein Ansinnen, PEN davon zu überzeugen, dass Literatur mit der Zeit geht und dass die Literatur sich nicht nur auf Poeten, Romanciers und Essayisten beschränkt. Neue Formen wachsen heran, Kunst wird auf neue Art und Weise hervorgebracht, und viele literarische Kunstwerke meiner Lebenszeit sind in Form von Songtexten entstanden. Es ist allerhöchste Zeit, anzuerkennen, dass Liedermacher genauso wie Verfasser von Theaterstücken, Essays und Romanen zur Literatur gehören.“
(Simon Schreyer, 2017)
✺ ✺ ✺
xx
xx
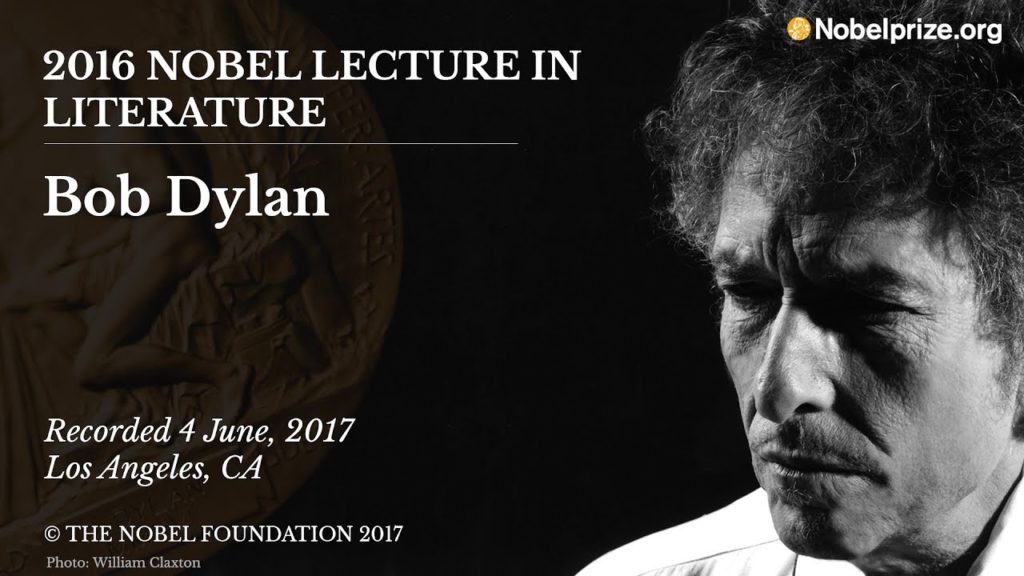
Comments