„Ich bin Schriftstellerin und ich bin frei.“
Ein Gespräch mit Isabella Bossi Fedrigotti, italienische Autorin und Journalistin, über komplizierte Männer und freie Frauen, das Bienenstock-Summen von Zeitungsredaktionen, die Freiheit des Fabulierens, Schreibmaschinen-Elfen und den Sprung ins kalte Wasser des Textbeginns.
(Simon Schreyer, 2021)

Als ich noch Kind war und auf den Partys meiner Eltern durch den Wald der Beine wuserte, bekam ich mehr mit, als den Erwachsenen lieb sein konnte.
Neben Ausgelassenheit und guten Schwingungen nahm ich auch anderes wahr: In manchen ihrer Gespräche ortete ich geharnischte Abwehr, in vielen ihrer Gesten erkannte ich Ausflucht. Ich schnupperte, wem unter den Gästen ein bestimmtes Aftershave oder Parfüm aus dem geballten Duftgemisch im Wohnzimmer zuzuordnen sei. Ich zählte, wie viele Drinks es bedurfte, um den rotgesichtigen Industriellen wieder mal im Ohrensessel zu fixieren und ich beobachtete, wer von den Erwachsenen uns Kinder überhaupt wahrnahm – uns, die wir unter ihrem Radar flogen, halb so groß waren und weit davon entfernt, als vollwertig zu gelten.
Unter den Gästen meiner Eltern fielen mir immer wieder dieselben Charaktere auf und manche von ihnen wurden mir sympathisch, ohne dass sie mich je eines Blickes würdigten oder das Wort an mich richteten. Waren die Feste meiner Eltern etwa ins Freie hinaus verlegt, war das meistens am winterlich-zugefrorenen Schwarzsee, wo man sich auf Einladung meines Vaters zum Eisstockschießen und Glühweintrinken traf, unter einer warmen Wolke aus Atem, die über der kalten, weiten Fläche schwebte.
Eine Dame in diesem immer wiederkehrenden Reigen an Gästen faszinierte mich mit jedem Mal mehr. Sie war spektakulär schön, ohne darauf stolz zu sein, schlank, mit rotblondem Haar und einer Körperhaltung, die ich im Nachhinein nur als distinguiert beschreiben kann.
Vor allem aber schien sie mir seelisch auf einer Art Metaebene zu existieren: Sie war gleichzeitig gesellig und voll präsent, aber es war so als zöge sie sich hinter die Ereignisse um sie herum zurück, in eine private Position der distanzierten Beobachtung. Sie war einer der Menschen, die ihre Sätze vertraulich mit „Weißt du, …“ beginnen. Ihr gewählter Ausdruck schien mir vom Satzbau her italienisch zu sein und sie sprach über so ganz andere Dinge als die meisten Erwachsenen, die sich über Fußball, Skirennen, Automarken, Benzinpreise oder Steuern echauffierten.
Im Vorüberlaufen und Herumtoben mit den anderen Kindern schnappte ich manchmal Wortfetzen auf, wenn sie sich mit meiner Mutter über Bücher und Politik unterhielt. Ich hatte keinen Schimmer, wovon sie sprach, aber es klang faszinierend. Sie schien mit der großen weiten Welt in Kontakt zu stehen und das war über kurz oder lang genau die Richtung, die ich seit meiner Kindheit einschlug.
Es hieß, diese Dame sei Journalistin und habe sogar ein erfolgreiches Buch veröffentlicht. Ich merkte mir ihren Namen: Isabella.
Im Herbst 2020 schließlich sitze ich Isabella Bossi Fedrigotti gegenüber. Die Art, wie die Journalistin und Schriftstellerin am Sofa die Arme verschränkt und die Beine übereinander schlägt, erinnert mich an meine Mutter, doch ihre Energie ist kontrollierter und weniger impulsiv. Isabella ist eine coole Lady mit viel Lebenserfahrung: Ihre Meinungen und Anekdoten möchte ich der Leserin nun nicht länger vorenthalten. Viel Vergnügen!
❦
Isabella, wie ist das Schreiben zu deinem Beruf geworden?
Mein erster Job war bei einer Frauenzeitschrift, in der ich mich um Bildunterschriften im Ressort „Garten und Küche“ kümmern musste, weil ich die einzige „vom Land“ war. Dabei habe ich weder vom Garten noch von der Küche irgendeine Ahnung gehabt. Dort war ich fünf Jahre. Letztendlich wurde die Frustration so groß, dass ich mir gesagt habe: Ich muss hier raus! Ich habe geträumt vom Schreiben. Aber niemand wollte mich.
Ich war ja bislang nur für Bildunterschriften zuständig gewesen und hatte nur unter Fotos geschrieben, um welchen Salat es sich hier handelt und solche Sachen… schließlich hat mir ein Kollege gesagt: „Schreib doch ein Buch!“
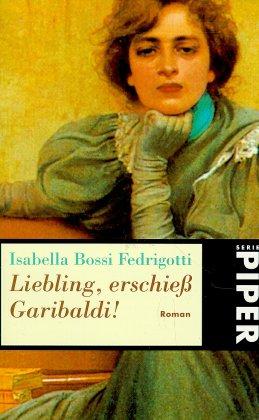
Und dieses Buch war Liebling, erschieß Garibaldi (Amore mio, uccidi Garibaldi, 1980)?
Genau. Zu der Zeit hat meine Mutter das Familienarchiv gründlich aufgeräumt, in unserem Haus in Rovereto. Dabei war sie auf Briefe meines Urgroßvaters an meine Urgroßmutter gestoßen, die sie uns laut vorgelesen hat. Niemand hat ihr zugehört – die eine wollte fernsehen, der andere wollte Zeitung lesen. Nur ich habe aufgehorcht und sie aufgefordert: „Erzähl weiter!“ Die Briefe konnte ich selber nicht lesen, da sie in Kurrent-Schrift verfasst waren, also hörte ich meiner Mutter zu und habe herausgeschrieben, was mir gefallen und was mich interessiert hat.
Wie hast du diese Familiengeschichte historisch verorten können?
Ich habe mir die Zeitungen aus der Epoche um 1860 herum in Bibliotheken und Archiven in Bozen, Trient und Rovereto besorgt. Die durchforstete ich nach Artikeln über jene Zeit, fand Memoiren von Pfarrern und Berichte über die Politik und die Kriegshandlungen.
…und dann habe ich halt begonnen, diese Briefe, die wie alle Familienbriefwechsel hauptsächlich vom Wetter, vom Geld und von der Verdauung handelten, auszufüllen mit historischem Hintergrund. So wurde daraus Liebling, erschieß Garibaldi, mein erster Roman. Das Buch hat Erfolg gehabt und mir zudem geholfen, beim Corriere della Sera unterzukommen, allerdings in der niedrigsten Position, bei der Stadtchronik und ähnlichen Ressorts.
Hat dir der Erfolg zumindest ermöglicht, gleich an weiteren Büchern zu arbeiten?
Ich wollte ja gar keine weiteren Bücher mehr schreiben. Mein Traum war es, Journalistin zu werden, nicht Schriftstellerin. Doch dann hat mich mein Verleger immer wieder aufgefordert, weiterzumachen: „Du hast eine Stimme! Du darfst dein Talent nicht begraben!“ und so weiter – also christlicher Zuspruch. Und so habe ich dann eben weitergeschrieben – parallel zu meiner Arbeit als Journalistin, die natürlich gefördert wurde durch meine Bücher, da diese ja teilweise ziemlich erfolgreich waren.
Was war deine letzte Position bei der Zeitung?
Insgesamt war ich 40 Jahre lang beim Corriere angestellt, bis vor zwei Jahren, jetzt bin ich freie Mitarbeiterin. Ich war zuletzt Articolista, so heißt das. Kommentatorin sagt man glaube ich auf Deutsch.
Hattest du auch eine Kolumne?
Ja, die habe ich jetzt noch, und zwar für das Mailänder Ressort in der Sonntags-Beilage.
Doch bevor ich aufgehört habe, hatte ich keine Kolumne, sondern verfasste Kommentare zur allgemeinen Menschheit, würde ich so sagen. Und ab und zu legte man den ‘fondo’, also den Leitartikel, in meine Hände. Je nachdem ob gerade ein Chefredakteur am Zug war, der einen schätzte. Manche Chefredakteure schätzen einen ja mehr, manche weniger, das ist ganz normal.
Ich glaube, ich war auch die erste Frau, die im Corriere della Sera den Leitartikel geschrieben hat.
Zwischen 1993 und 1997 hast Du für den Corriere von Madrid aus gearbeitet, nicht wahr?
Mein Mann, Ettore Botti, der auch Journalist war, war dort Korrespondent für den Corriere. Wir hatten uns ja ursprünglich in der Redaktion kennengelernt. Wir waren beide fast gleichzeitig, ich zwei Wochen vor ihm, bei der Zeitung aufgenommen worden, im selben Ressort. Unsere Schreibtische standen zusammen und wir teilten uns ein Telefon, damals gab es ja noch keine Handys. Also konnten wir uns keine Lügen erfinden, „heute kann ich nicht, weil meine Mutter krank ist“, oder so (lacht).
Mein Mann hat später eine Innenkarriere gemacht. Er war viel ambitionierter als ich und so wurde er für vier Jahre Korrespondent aus Madrid. Ich musste in dieser Zeit meine Fixanstellung lassen und erhielt einen Mitarbeitervertrag. Als wir wieder nach Mailand zurückkehrten, wurde ich beim Corriere wieder regulär eingestuft.
Welche Rolle spielt deine Trentiner Herkunft in deinem Leben?
Trentino hat einen guten Namen in Italien. Vielleicht auch im Ausland, aber auf jeden Fall unter den Italienern: Die Trentiner werden immer als die guten, alt-österreichischen Untertanen gesehen. Trentino ist ein Land mit viel Geschichte. Es hilft, wenn viel Geschichte hinter einem steht.

Zumindest habe ich gemerkt, dass es mir hilft, aus einer Provinz zu kommen, in der die Geschichte einen anderen Lauf genommen hat, als im übrigen Italien. Das hat mir eigentlich immer ein gutes Zeugnis mitgegeben.
Meine Trentiner Herkunft mag auch dafür gesorgt haben, dass ich so manchen Job bekommen habe statt jemand anderer. Natürlich hat mir auch mein Deutsch geholfen, bei Interviews und Kontakten für Recherchen. Du weißt ja, wie es in Redaktionen läuft: Oft heißt es, „ruf den Schriftsteller X an und lass dir sagen, was er darüber denkt!“ Ich habe auf diese Weise die deutschsprachige Welt für die Zeitung abgedeckt.
Was hat dich vom Trentino gerade nach Mailand gezogen?
Na ja, es war halt naheliegend, in die große Stadt zum Studieren zu gehen und im Fall unserer Familie war das nicht Padua, sondern eben Mailand, da zwei meiner Brüder bereits dort studierten. Mein Vater hat sich immer nach Mailand hin orientiert.
Was hat dir Tirol in deiner Kindheit bedeutet?
Ach, Tirol habe ich immer sehr geliebt. Meine Mutter, eine Wienerin, hat uns jeden Sommer für einen Monat zu unseren Cousins, der Familie Trapp, mitgenommen. Die leben auf Friedberg bei Volders, in der Nähe von Innsbruck. Ich erinnere mich an die Spaziergänge im Wald, an das Milchholen beim Bauern. Es war ein Traum.
Rovereto ist ein italienischer Ort, in dem man kaum Deutsch gesprochen hat, damals noch mehr als heute. Auch meine Mutter hat Tirol geliebt. Daher ist sie oft, auch mit uns, nach Bozen gefahren. Dort hat sie sich schon mehr zu Hause gefühlt als in Rovereto und hat Schwarzbrot und Schüttelbrot von dort mitgebracht. Das war ihre Kultur, die auch wir mit Begeisterung aufgesogen haben.
Reist du gerne?
Jetzt nicht mehr. Ich war in Indien, ich war in Russland… früher war ich mit meinem Mann einmal in Südamerika. Wir wollten eigentlich viel mehr reisen, aber wir hatten unsere Arbeit und wir hatten unsere beiden Söhne. Die wollten wir nicht allein lassen bevor sie 18 waren. Mailand ist kein besonders gutes Pflaster für Teenager. Gerade für Burschen, weil sie ihre Mutproben abliefern müssen, Joints rauchen und solche Sachen. Um zu zeigen, dass sie Männer sind. Deshalb wollten wir uns die Reisen aufheben bis sie volljährig waren. Doch als sie dann in dem Alter waren, ist mein Mann gestorben.
Seitdem interessieren mich weite Reisen nicht mehr und alles andere habe ich eh alles im Fernsehen gesehen. Ich will nicht nach Japan, will nicht nach China, will ich alles nicht. Ich habe aber eine deutsche und eine russische Schwiegertochter und stehe daher zur Genüge mit der Fremde in Kontakt (lächelt).
Hat deine journalistische Arbeit dich auch auf Reisen geführt?
Ja, doch, für Interviews war ich schon öfter in Europa unterwegs. 1999 war ich zum Anlass „Zehn Jahre Mauerfall“ in einigen ehemaligen Staaten des Ostblocks unterwegs: Tschechien, Slowakei, Ungarn, Serbien, Rumänien, Bulgarien. Mein Auftrag war es, herauszufinden, was sich für die Menschen dort in den vergangenen zehn Jahren verändert hatte, vom Professor bis zum Taxifahrer.

Gerade der Taxifahrer gab mir eine der bemerkenswertesten Antworten auf meine Frage, was die letzte Dekade mit sich gebracht habe. Er sagte nur: „Sentimental experience, sentimental experience!“ Ich dachte, er sei aufgrund der Öffnung des Landes seiner großen Liebe begegnet. Aber als ich nachfragte, was denn seine sentimental experience gewesen sei, erzählte er, er habe Julio Iglesias auf dessen Tournee wochenlang mit dem Auto durch Rumänien chauffiert. So eine Erfahrung war für ihn vor dem Fall des Eisernen Vorhangs noch nicht in den Sternen gestanden.
Ist dir das Schreiben deiner Romane von Anfang an leicht von der Hand gegangen oder war das auch mühsam?
Ich war halt jung und voller Eifer. Aber es war nicht so schwer. Liebling, erschieß Garibaldi! war ja ein Roman in Briefform. Das Schreiben in der Ich-Form war mir schon lang geläufig. Ich hatte ja jahrelang Tagebuch geschrieben und Romane habe ich geschrieben seit ich zwölf Jahre alt war. Schreckliche Sachen! (lächelt) Und dann natürlich meine eigenen Briefe – ich war ja fünf Jahre lang im Klosterinternat und wahnsinnig unglücklich. Also hatte ich Übung.
Beim Schreiben in der ersten Person ist es ja leichter, seine Gefühle auszudrücken und überhaupt offener zu schreiben. Danach habe ich gewechselt. Die anderen Bücher habe ich dann nicht mehr in der ersten Person geschrieben.
Welcher war dein nächster Roman nach Garibaldi?
Das war dann Casa di guerra (Longanesi, Mailand 1983), der aber nicht auf Deutsch erschienen ist. Dieses Buch, so wie das erste, lebt auch sehr von den Erinnerungen meiner Familie, diesmal aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.
Es geht darin um unser Landhaus in Rovereto, das von den Deutschen auf dem Rückzug besetzt wurde. Ein deutscher General zog mit seinen Soldaten in mein Elternhaus ein, nicht wissend, dass mein Vater Partisan war und einen im Heuboden einer Scheune versteckten englischen Fallschirmspringer mit Lebensmitteln versorgte. Der General beanspruchte den Großteil des Hauses für sich und meine Eltern luden ihn zwangsläufig abends zum Essen ein. Doch eines Abends fragte er sie: „Und, wie geht es Ihren englischen Gästen?“ Da er morgens am Fenster Tagebuch führte, hatte der General meinen Vater beobachtet, wie er in aller Herrgotts Früh mit einem Rucksack zur Scheune im Wald ging.
Solche Erinnerungen und Familienerzählungen nahm ich zum Ausgangspunkt für meinen Roman über diese Zeit.
Welche Schriftstellerinnen oder Schriftsteller hatten Einfluss auf dein eigenes Schreiben, auf deine Stimme und deinen Stil als Erzählerin?
Natalia Ginzburg war meine Lehrerin – im Kopf. Sie war meine Lehrerin deshalb, weil sie sich getraut hat, autobiografisches in Romanform zu bringen.
Dasselbe gilt für eine andere italienische Autorin, die Lalla Romano heißt und ebenfalls wunderschöne autobiografische Sachen geschrieben hat. Und dann Marguerite Yourcenar, die auch von ihrem zu Hause erzählt hat. Das waren meine drei Lehrerinnen. Sie wissen es nicht, aber sie waren es (lacht).

Dein Buch Palazzo der verlorenen Träume (orig. Magazzino Vita, Mailand 1996) steht in meiner Bibliothek neben Bagheria von Dacia Maraini. In beiden Büchern spielt ja jeweils ein Haus sozusagen die Hauptrolle. Gibt es da auch eine geistige Nachbarschaft zu ihr?
Dacia Maraini kenne ich gut. Sie ist eine sehr liebe und nette Person. Von ihren Büchern hat auch mir Bagheria am besten gefallen.
Wie geht es aus deiner Sicht der italienischen Literatur?
Es geht ihr miserabel, denn es liest ja kein Mensch. Es werden hunderte Bücher verlegt, aber verkaufen tun sich nur jene der Influencer, die gerade aktuell sind. „Resistere!“ – wir müssen durchhalten!
Schreibende sind immer auch Beobachter und Außenstehende – ja, man muss beinahe außenstehend sein um präzise beobachten zu können. Kennst du, gerade weil du über deine Familie schreibst, den Konflikt zwischen der Schriftstellerin und der Schwester, der Tochter, der Mutter in dir?
Ein kluger Verleger, mit dem ich befreundet bin, hat mir einmal geraten: „Ein Schriftsteller muss vergessen, dass er Familie hat.“
Doch was meine eigene Familie betrifft, anhand deren Erzählungen ich ja meine Bücher geschrieben habe: Natürlich habe ich von ihnen Andeutungen zu hören bekommen, dass ich dies und das nicht hätte schreiben sollen. Aber ich bin frei. Ich bin eine Schriftstellerin und ich bin frei. Ich kann schreiben, was ich will. Es muss ja nicht real sein, was ich schreibe.
Mein Bruder hat immer geglaubt, das sei eins zu eins nacherzählt und korrigierte mich, dass dieses und jenes Ereignis sich nicht genau so zugetragen hat, wie ich es in meinem Buch beschrieben hatte. Ich kann dem nur entgegnen: Es ist ja nur ein Buch, es ist nur eine Erzählung.
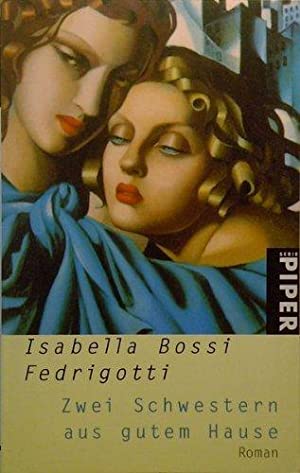
Das narrative „ich“ bist ja nicht du.
Genau. Das „ich“ bin ja nicht ich. Diese Familie, das seid nicht ihr. Doch ganz grundsätzlich war meine Familie immer sehr zurückhaltend und hat sich über den Erfolg meiner Bücher gefreut, besonders meine Mutter.
Mein Vater, erinnere ich mich, war nach Erscheinen meines ersten Buches, welches viel besprochen wurde, im Speisewagen der italienischen Bahn neben einem Herrn zu sitzen gekommen. Nachdem sie ihre Namen ausgetauscht hatten, fragte ihn der Sitznachbar, ob er mit der Schriftstellerin verwandt sei. Das hat meinen Vater natürlich heimlich geärgert, denn immerhin trägt ja seine recht berühmte Weinkellerei unseren Familiennamen.
Hast du beim Schreiben Rituale oder gehörst du zu den Glücklichen, die sich einfach an einen Tisch setzen und los geht’s?
Nein, leider… Am besten schreibe ich immer noch zu Hause, wo ich alles rund um mich herum kenne. Wo mich nichts neugierig macht. Auch keine Geräusche, wie vorbeifahrende Autos.
Ich habe einmal eine Kurzgeschichte (Der Fornit, orig. The Ballad of the Flexible Bullet, 1984) von Stephen King gelesen, über einen spinnerten Schriftsteller, der Angst hat vor dem leeren Blatt Papier: Wie anfangen? Wo beginnen? Schließlich steht er auf und geht in die Küche, holt Kekse und kehrt an den Schreibtisch zurück. Von den Keksen fallen jedoch Brösel in die Schreibmaschine hinein und wie von selbst beginnen sich die Tasten niederzudrücken: Tak, tak, tak, tak! Von nun an ist er überzeugt, dass in seiner Schreibmaschine ein kleiner Elf lebt, ein sogenannter Fornit. Den muss er immerzu füttern, um schreiben zu können.
Nur soviel zum Thema ‘writer’s block’, mit dem sich offenbar auch ein Bestseller-Autor wie Stephen King auseinandersetzt.
Hattest du nie Angst vor dem leeren Blatt?
Als Journalistin hatte ich nie Angst vor dem leeren Blatt, nein. Das war schlichtweg nicht erlaubt. Da hast du nur diese anderthalb oder drei Stunden, um deine Story fertig zu schreiben. Also musst du ins kalte Wasser springen! Da gibt’s nix, auch wenn das Wasser eiskalt ist. Das habe ich vom Journalismus gelernt, dass ich sofort anfangen kann. Sofort. Schließen kann ich auch gut, das Schwierige ist für mich in der Mitte.
Auch gestern war das so – ich schreibe zurzeit eine zehnte und letzte Kurzgeschichte für eine Sammlung und da habe ich gestern Abend den Sprung ins kalte Wasser getan und den Anfang geschrieben. Also: ich habe zwar keine Angst vor dem leeren Blatt aber ich gehe auch immer wieder in die Küche und hole mir Kekse (lächelt).
Um den Elf in der Schreibmaschine zu füttern?
Genau (laucht). Naja, das sind halt so meine Rituale. Und natürlich muss ich auch hier in den Ferien in Kitzbühel schreiben und kann mir nicht erlauben, die Zeit wegzuschmeißen. Das ist aber viel schwieriger als daheim, denn hier gibt’s mehr Sachen, die mich zerstreuen. Es rufen Freundinnen an – nicht die üblichen, die wissen, dass ich arbeite und dass man mich eher am Abend stören kann.
Es gibt andererseits auch Schriftsteller, die total vereinsamen. Solche, die niemanden mehr treffen, weil sie denken, das stehle ihnen nur die Zeit…
Also, ich sterbe, wenn ich niemanden treffen kann.
Besonders für Journalisten ist doch der persönliche Austausch enorm wichtig. Wenn du mit niemandem sprichst, keinen Meinungsaustausch hast, wie willst du dir eine Meinung für einen Kommentar oder für eine Kolumne bilden?
Mir geht das Leben in der Redaktion schon sehr ab: das vielstimmige Summen wie in einem Bienenstock, die Kollegen, mit denen man sprechen kann, die einen mit Ideen beliefern, mit anderen Gesichtspunkten. Ich habe einen Kollegen in Verona, der ist sozusagen mein privater Chefredakteur. Den rufe ich an und frage ihn: Was sagst du dazu? Und er sagt mir was! Zur Zeit muss einer meiner Söhne herhalten, wenn ich mich mit jemandem über ein Thema besprechen will.
Es ist viel schwieriger, alleine zu schreiben. Natürlich muss man als Schriftsteller alleine sein, aber in der Einsamkeit könnte ich nicht leben.
„Männer und Frauen stehen an gegenüberliegenden Flussufern. Sie rufen sich zu, aber sie können sich nicht mehr verstehen, weil der Fluss so laut rauscht.“
Das erste Buch von dir, das ich gelesen habe, war Unter Freundinnen (Il Catalogo delle Amiche, Rizzoli 1998, auf Deutsch erschienen bei Piper, München 2001). Deine Beobachtungsgabe und Menschenkenntnis haben mich sehr amüsiert…
… und dieser Tage arbeite ich gerade am Nachfolgeband: einer Geschichtensammlung mit dem Titel Unter Freunden. Neun habe ich bereits, mit dem zehnten habe ich, wie gesagt, gestern begonnen.
Frauen kenne ich, daher war es ein Spaziergang für mich, als ich vor zwanzig Jahren Unter Freundinnen geschrieben habe. Männer hingegen sind mir immer ein Geheimnis geblieben. Es war daher für mich furchtbar schwer, die zehn männlichen Protagonisten für diesen Band aufzustellen.

Weshalb rechnest du dir so wenig Chancen aus, Männer zu verstehen? Immerhin hast du zwei Söhne.
Nun, die Männer sagen ja immer, sie seien viel einfacher gestrickt als die Frauen. Das ist eine Antwort, die ich oft bekomme.
Das bezweifle ich, ehrlich gesagt. Ich denke, Männer sind auf ihre Art genauso kompliziert wie Frauen.
Genau! Aber mir sind die Komplikationen der Frauen vertrauter. Und auch meine Söhne repräsentieren ja nur ein Männermodell, wenn man so will. Und es gibt heutzutage ja so viele Männermodelle. Vielleicht hängt es mit meinem Älterwerden zusammen, dass ich weniger verschiedene Männertypen kenne. Über meine Söhne würde ich jedoch nie schreiben (lächelt).
Jedenfalls hoffe ich, dass deine neue Geschichtensammlung über Freunde ebenso psychologisch präzise und ein bisschen boshaft, aber letztendlich liebevoll ist wie jene über die Freundinnen.
Ja, das hoffe ich auch. Jemand hat über das Buch Unter Freundinnen geschrieben, es sei ein Werk von jemandem, der die Frauen hasst. Aber das ist es ja gar nicht.
Das ist es definitiv nicht. Ich habe eine große Solidarität der Erzählerin mit ihren Figuren gespürt. Sind sie alle Mischungen aus verschiedenen Frauen in deinem Leben oder hat sich auch eine Person aus deinem tatsächlichen Umfeld in einer Figur wiedergefunden?
Das ist bei zwei bis drei Figuren, etwa bei Margherita, der Fall. Und bei einer anderen, einer guten Freundin von mir. Die hat sich erkannt. Sie weiß, dass ich weiß und ich weiß, dass sie weiß. Wir haben aber kein Wort darüber geredet.
Wie denkst du über die gesellschaftliche Stellung der Frauen von heute?
Die englische, feministische Schriftstellerin Fay Weldon hat mir bei einem Interview gesagt: „Die Männer haben die Frauen über Jahrhunderte schlecht behandelt. Ich stelle aber fest, dass viele jüngere Frauen, besonders in England, ihre Männer schlecht behandeln.“ Das ist eine Beobachtung, die ich auch bei einigen der Ex-Freundinnen meiner, mittlerweile verheirateten, Söhne gemacht habe. Die konnten schon manchmal sehr aggressiv werden.
Denkst du, Fay Weldon zu Folge, dass es sich dabei um eine Art Revanchismus handelt für all die Jahrtausende der Unterdrückung durch die Männer?
Ja, natürlich! Die Situation ist inzwischen sehr verfahren. Ich habe manchmal den Eindruck, Männer und Frauen stünden an gegenüberliegenden Flussufern. Sie rufen sich gegenseitig zu, aber sie können sich nicht mehr verstehen, weil der Fluss so laut rauscht.
Man muss auch sagen: Frauen haben sich wahnsinnig verändert in den vergangenen Jahrzehnten. Dadurch, dass sie hinausgehen und arbeiten dürfen, hat sich ihnen die Welt eröffnet. Es wird daher eine Zeit dauern, bis sich die Frauen in diese neuen Bedingungen eingelebt haben und sich in ihnen wohlfühlen. Und es wird auch eine gewisse Zeit brauchen, bis sich auch die Männer an diese neue Situation gewöhnt haben.
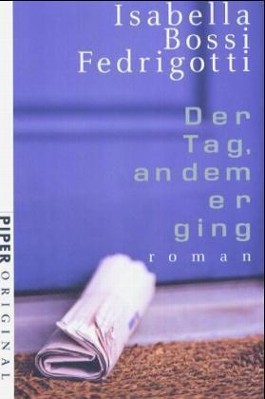
Und dann werden sie sich wieder besser verstehen?
Ja, da bin ich optimistisch. Natürlich gibt es auch noch immer Benachteiligungen für die Frauen: weniger Lohn für dieselbe Arbeit, wenig Vertretung durch die Politik.
„Nachts fürchte ich mich vor diesem Zerbröckeln der zivilisatorischen Sicherheiten. Bei Tag bin ich optimistisch.“
Denkst du, dass das Zerbröseln patriarchaler Strukturen unserer Gesellschaft auch für die Männer eine Befreiung sein könnte?
Die Männer haben eine Kultur von Jahrtausenden hinter sich. Das ist eben das schwer Überwindbare dabei. Es ist, als ob man den Männern den Thron wegziehen würde, auf dem sie seit Jahrtausenden sitzen.
Jede praktische Ärztin und jeder Physiotherapeut würde das befürworten, denn so lange zu sitzen ist ja gewiss ungesund, nicht?
Das stimmt (lächelt), aber man weiß andererseits auch nicht, was an die Stelle der Patriarchen treten wird. Wird anstelle des Mannes die Frau am Thron sitzen? Oder wird es wirklich eine Gleichstellung geben? Man weiß es nicht.
Dieser Machtverlust ist sehr schmerzhaft für die Männer. All diese Frauen, die von ihren Männern umgebracht wurden… es sieht so aus als ob diese Fälle immer mehr werden, und in den meisten Fällen waren diese Männer von ihren Frauen, Freundinnen oder Verlobten verlassen worden. Mir scheint, das sind Männer, die nicht von ihrem Thron aufstehen konnten.
Und die Demütigung nicht hinnehmen können, von der Frau verlassen zu werden, weil sie frei, also nicht „dem Manne hörig“ ist?
Ja, und je freier die Frau wird, um so öfter geht sie ihrer eigenen Wege. Auch die Scheidung ist da keine große Hürde zur Freiheit mehr, sondern deren Begünstigung, weil das Scheidungsrecht Frauen sehr bevorteilt: Die Frau kann damit rechnen nach der Trennung die Wohnung, das Sorgerecht und manchmal auch viel Geld zu erhalten. Die Gesetzeslage richtet sich noch immer nach der Vorstellung, eine Frau habe kein eigenes Einkommen und sei immer daheim am Herd. Aber die moderne Frau ist eben nicht mehr nur zu Hause, sondern geht meistens ihrer eigenen Arbeit nach.
Nicht selten zieht im Fall einer Scheidung der neue Freund in die Wohnung ein, die der Mann oder dessen Familie finanziert hat und der Mann muss mitansehen, wie er nicht nur seine Frau und die gemeinsame Wohnung verliert, sondern wie seine eigenen Kinder mit einem anderen Mann aufwachsen. Das ist natürlich zum Schießen und für den Mann sicherlich eine unerträgliche Situation. In vielen Fällen hat der geschiedene Mann dann nicht mal mehr Geld um sich eine eigene Wohnung zu mieten und ist am Ende sogar gezwungen, im Auto zu wohnen.
Das ist natürlich auch ein hartes Schicksal und eine Schmach. Andererseits sehe ich gerade in meiner Generation sehr viele Patchwork-Familien, die nicht nur funktionieren, sondern auch weitgehend harmonisch sind.
Ja, ja, ich weiß. Ich weiß aber auch, dass es für ein Kind sicher nicht leicht sein kann, zwei Väter zu haben, besonders wenn der leibliche Papa nach einem Besuch wieder für Monate aus dem Leben des Kindes verschwindet. Da wird jeder Besuch zu einem emotionalen Erdbeben.
Wir leben in einer Zeit, in der das Dasein für uns alle auf der Gefühlsebene seismografisch hochaktiv ist. Wie gelingt es dir, damit umzugehen?
Das Gehirn des Menschen stammt aus der Steinzeit: Wenn es finster wird, fürchtet es sich. Und in der Nacht fürchte ich mich auch vor diesem Zerbröckeln der zivilisatorischen Sicherheiten. Bei Tag bin ich optimistisch (lächelt).

Welche positiven Entwicklungen siehst du im Zusammenhang mit Corona?
Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die sehe. Ich hoffe natürlich auch, dass Corona und die damit einhergehende ökonomische Krise uns eines Besseren belehren wird. Meine Vermutung aber ist: Wer vor Corona wirtschaftlich gut aufgestellt war, wird danach noch besser dastehen, wer schon vor Corona schlecht dagestanden ist, wird danach noch schlechter dastehen.
Welche positiven Entwicklungen stellst du an den Menschen fest? Sind wir auf ganz lange Sicht besser und feinfühliger geworden?
Ja, das schon! Wenn wir über europäische Verhältnisse sprechen – denn von außerhalb Europas hört man noch immer viel Schreckliches – muss man sagen, dass auch bei uns Kinder und Frauen früher wie Vieh gesehen und behandelt wurden. Wenn ich Geschichten von der „guten alten Zeit“ höre, kann ich nur sagen: So gut war diese alte Zeit gar nicht. Außer man war bei der ökonomischen Elite oder von Adel und verbrachte sein Dasein damit, zwischen zwei Schlössern hin- und herzuwechseln.
Und noch etwas: Unsere Sensibilisierung verträgt keine wilden Massaker mehr. Da muss man einfach auch mal zurückgreifen und in den Geschichtsbüchern lesen. Und wenn ich die Geschichte nicht vergesse, dann muss ich zugeben, dass es heute für viele Menschen besser ist, als in der Vergangenheit.
Dankbarkeit: ein wichtiges Gefühl für dich?
Ich schaue auf mich, dass ich immer dankbar bin, wenn jemand lieb ist zu mir oder mir irgendetwas Gutes tut. Ganz grundsätzlich bin ich wahnsinnig dankbar für mein Dasein.

Wem bringst du deine Dankbarkeit entgegen?
Dem lieben Gott, so es ihn gibt (lächelt).
Ich führe ein sehr privilegiertes, erfülltes Leben. Ich erinnere mich an den ersten Lockdown im März. Der hat unsere Familie erwischt, als wir alle gerade hier in Kitzbühel waren – auch meine Schwester mit ihrer Familie. Unsere Söhne sind daraufhin oft miteinander in die Berge gegangen und meinten, sie würden bis zur Pension nie mehr drei Monate Urlaub mit ein bisschen Homeoffice zwischendurch haben. Letztendlich wurden diese Monate der Notsituation für uns als Familie die schönsten großen Ferien meines Lebens.
Wenn man bedenkt, wie viele Familien, vielleicht sogar noch mit mehreren Teenagern, den Lockdown in einer 60-m²-Wohnung in einer Großstadt erleben müssen, dann geniere ich mich fast. Daher kann ich einfach nur Dankbarkeit empfinden.
❦
– Kurzes Interview (ital.) über Das Feld von Robert Seethaler und Anna Karenina von Leo Tolstoi
– Interview (ital.) über den Journalismus und die Schriftstellerei