CATCH ME IF YOU CAN
Der talentierte Mr. Kracht

„Erzähl mir doch etwas.“
„Wahrheit oder Fiktion?“
„Das ist mir egal. Entscheide Du!“
– aus Eurotrash
„Ich glaube ja, Kracht ist der letzte Punk. Seine ganze Inszenierung als scheintoter, affektiert stotternder Pimpf in Lodenjacke und mit Edelweiß am Revers ist meiner Meinung nach nur die subversive Kunstfigur eines Kultur-Rabauken, der sich ein Dosenbier aufzischt, wenn er heimkommt, die Beine hochlegt, seinen geleckten Seitenscheitel zerwuselt und The Clash hört bis die Nachbarn klopfen“, kommentierte ein nicht näher bekannter User auf YouTube unter eine Ausgabe von Willkommen Österreich, in welcher der moderne deutschsprachige Schriftsteller Christian Kracht 2007 zu Gast war.
So ist das aber nicht. Zunächst einmal würde der mittlerweile weltbekannte Autor Abstand nehmen von Dosenbier. Ich nehme auch an, The Clash wäre ihm zu sehr Pop für Punk und Punk zu hässlich für Pop. Und zur Haartracht: Die FM4-Film- und Kulturredakteurin Pia Reiser ist der Meinung, ein strenger Scheitel wäre eine der wenigen Frisuren, die ein Mann heutzutage tragen könne und die man nicht einfach den Rechten überlassen dürfe. Da vertraue ich einfach mal dem guten Geschmack dieser österreichischen Pauline Kael.
Dass das Edelweiß in Christian Krachts Büchern nicht ein Emblem von White Supremacy, sondern Symbol spiritueller Reinheit ist, nehme ich selbstverständlich zur Kenntnis. Schließlich habe ich ja auch Asterix bei den Schweizern gelesen, worin diese scheue, hochalpine Blume zentrale Ingredienz im Druiden-Heiltrunk für den vergifteten Quästor Claudius Incorruptus ist. Allerdings: Christian Kracht ist die Kunstfigur des subversiven Kultur-Rabauken Christian Kracht, das kann ich getrost unterschreiben und möchte das in diesem Text genauer untersuchen.
Die hochbegabte und hochneurotische Edelfeder Truman Capote beherrschte die Fähigkeit, auch im Gespräch geistreich und spontan druckreif zu antworten. Diese Fähigkeit fehlt der öffentlichen Person Kracht auf seltsamste Weise, ist er doch vielmehr eine Art Privatgelehrter, still und verinnerlicht, abgehoben und schüchtern in einem. Folglich wandern seine Zuhörer durch eine zerrupfte Steppe aus „ääähs“ und „ähms“ und „ja, so könnte man das, äh, also sagen“. Tatsächlich ist sein Zaudern wohl Ausdruck von Unsicherheit und weit weniger strategische Inszenierung einer Verweigerung oder eines kalkulierten Refus der eindeutigen Aussage. Aber ganz eindeutig kann ich das auch nicht sagen.
Eine seiner Romanfiguren jedenfalls, die zufällig auch Christian Kracht heißt, bekennt sich zur Angst vor der Plattitüde, vor der Konvention und vor der Konversation, die nicht amüsiert: „Niemals war irgendetwas, was ich sagte, auf irgendeine Weise relevant gewesen, nie konnte mein Gesprochenes es mit meinem Inneren aufnehmen.“ Und ebendiese Romanfigur an anderer Stelle: „Mein Vater war vollkommen autistisch in Gesellschaft. Das habe ich von ihm.“
Was Christian Kracht junior von Christian Kracht senior noch hat, ist eine subtile Angeberei als Schutzmaßnahme, die wohl aus derselben Unsicherheit resultiert. Kracht: „In Wahrheit will ich nur mit Bildung angeben, so wie mein Vater mit seinem Vermögen. Der große Unterschied dabei war, dass mein Vater tatsächlich Geld gehabt hatte, ich aber keinen Funken Intellekt.“
Das hat Kracht nämlich auch vom Vater – das viele Geld, das der Generalbevollmächtigte des Axel-Springer-Konzerns während der 1950er und 60er Jahre erwirtschaftete. Sein Salär umfasste (so wird geraunt) 1,3 Millionen Deutsche Mark pro Jahr und erlaubte der Familie Kracht, mehrere Wohnsitze zu beziehen — in Gstaad, Mayfair, auf Sylt und Cap Ferrat in Südfrankreich.
Durch das moralisch so fragwürdige Springer-Vermögen ist Christian Kracht von Haus aus reich, ein Umstand, den er anscheinend auch möglichen literarischen Kollaborateuren ins Ohr zu flüstern pflegte, Harald Schmidt gegenüber jedoch entschieden zurückweist.

Dieser sagenhafte Reichtum, der (ähnlich wie in klassischen antiken Sagen) mit einem Preis kam, wie wir im Roman Eurotrash (2021) lesen können, ist auch einer der Faktoren, der Christian Kracht in der deutschen Neidgesellschaft seit jeher einen Hot Seat bescherte, ja, ihn vielen seiner Zeitgenossen von vornherein als unsympathisch erscheinen ließ. Warum ist das so?
Nun: Steinreiche können niemals so sein wie „normale“ Bürger – es fehlt ihnen die Erfahrung der sozialen Ausgesetztheit, der Peinlichkeit der Pleite, der egalitären Perspektive. Das kann man nicht mehr nachlernen, wenn man mit Kohle satt aufgewachsen ist. Das ist der feine Unterschied.
Man lese dazu das Kapitel in Der gelbe Bleistift (2002) mit dem Titel „Tristesse Royale“, in dem er einen Abstecher nach Berlin schildert, wo er einer diffus motivierten Demonstration von vermeintlichen Wohlstandsverweichlichten beigewohnt hat. Im Vergleich dazu fühlt sich die Rückkehr nach Südostasien zur harten Realität eines Minen-verseuchten Phnom Penh „gut und richtig“ an, so als ob alleine seine Anwesenheit die unterirdischen Sprengkörper entschärfen würde. Oder fühlt es sich „gut und richtig“ an, da er dort keine Westeuropäer mit ihren Luxusproblemen ertragen muss?
Alles sagen zu können, ohne es zu fühlen: Das Gütesiegel für Privilegierte allerorts, wenn ein Problem kein Problem ist, weil es nicht das eigene Problem ist. Erben alten Geldes, soziale Aufsteiger und neokonservative Politiker fassen das in das schöne Bonmot: „Eure Armut kotzt mich an.“ Kracht fasst es jedoch in reflektiertere Worte: „Wir waren feige Popper. Und wir erkannten: Hier in Kambodscha hört die Popkultur auf. Es gab hier keinen ironischen Bruch zwischen dem, was ist und dem, was sein sollte. Hier ging es um zwanzig Dollar mehr im Monat.“
Geschwindigkeit, Rastlosigkeit, Oberfläche
Was trägt noch zu seiner unvorteilhaften persona publica bei? Sorry to say so, aber der junge Kracht sah aus wie sich Hollywood einen SS-Mann vorstellt. Noch dazu kokettierte er in der Vergangenheit mit Krieg und Regime, womöglich als heilsames Gegenmittel gegen die verwöhnte Verkommenheit des Westens, auch seine eigene.
Und zu alldem auch noch der Neid. Ehrlicherweise auch der meine. Ich beneide Christian Kracht, denn er kann es sich leisten, dieser Tage in Buenos Aires, nächste Woche in Kyoto und im nächsten Monat wieder in Bangkok zu leben. Und er macht von dieser Möglichkeit auch vollen Gebrauch. Publicity betrachtet er korrekterweise als Performance. Er gehört zur markenbewussten New-Wave-Generation, galt Mitte der 1990er als Vorreiter einer jungen deutschsprachigen Popliteratur. Kracht war damals synonym für Geschwindigkeit, Rastlosigkeit, Oberfläche.
Dabei war Kracht weder sonderlich Pop, noch sonderlich jugendlich, sondern klassisch gebildet und vor allem: sonderlich. Immer schon war er ein Solitär. Auch als Teil des sogenannten popkulturellen Quintetts umkreiste er Deutschland als Satellit.

Zudem gibt sich Kracht als Schweizer (der er ja dem Geburtsort und dem Pass nach ist), obwohl er deutscher nicht sein könnte – ein Schweizer, wohlgemerkt, der „den Akzent abgelegt habe“, aber in seinen Romanen das scharfe S verteidigt. Nur in Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten (2008) fehlt es, da der Erzähler ja ein (schwarzer) Schweizer Offizier ist, der im Übrigen sein Herz wortwörtlich am rechten Fleck hat.
In Blow Up, der Autobiografie eines anderen Schweizer Journalisten und Autors, Tom Kummer, begegnen wir einem Redaktionsassistenten in den Hamburger Räumlichkeiten der Lifestyle-Postille Tempo.
Kummer: „Ein junger, blondhaariger Schnösel betrat irgendwann (1989; Anm.) die Redaktion. Er war Volontär oder irgendwas in der Art und stellte sich als Christian vor. Er sei Schweizer. Das konnte ich kaum glauben, denn der Blonde konnte kein Schweizerdeutsch, was sehr lustig war. Ein Schweizer, der keinen Dialekt spricht – davon hatte ich noch nie gehört.“
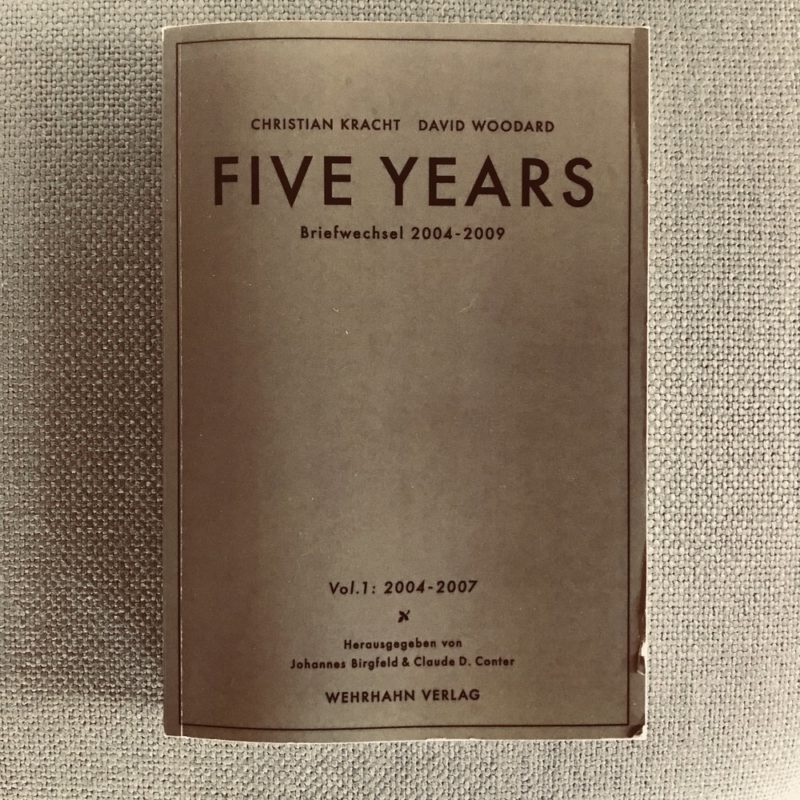 In seiner gesammelten Korrespondenz Five Years (2011), die er mit dem exzentrischen amerikanischen Traum-Maschinisten und ideologischen Rechtsaußen-Verteidiger David Woodard führte, machte er sich abstruse Gedanken über das Überleben der Germanen am Beispiel deutscher Auswanderer im Dschungel von Paraguay.
In seiner gesammelten Korrespondenz Five Years (2011), die er mit dem exzentrischen amerikanischen Traum-Maschinisten und ideologischen Rechtsaußen-Verteidiger David Woodard führte, machte er sich abstruse Gedanken über das Überleben der Germanen am Beispiel deutscher Auswanderer im Dschungel von Paraguay.
Gemeinsam mit Woodard begab er sich dann auch auf die Spuren Aleister Crowleys in Cefalù, Sizilien. Naheliegend: Auch Crowley war ein agent provocateur, ein Snob und Okkultist von ruiniertem Ruf.
In seinem zweiten Roman 1979 (2001) glaubt Krachts Erzähler tatsächlich ein Hakenkreuz an der Südflanke des heiligen Berges Kailash in Tibet zu erkennen. Auch wenn das Swastika-Symbol im Hinduismus und Buddhismus seine Heimat hat, ich nenne mehrere Bildbände über diesen Berg mein Eigen und kann besagtes Couloir bestenfalls als nie zu erreichendes Traumobjekt einer Snowboard-Base-Jump-Befahrung deuten. Von Hakenkreuz keine Spur. Doch so sieht jeder, was er sehen möchte. Rashomon mon amour.
Sein witzig-wahnwitziger und eingängig zu lesender Südsee-Roman Imperium (2012) führte einige Rezensenten auf falsche Fährten und verführte so manchen Auf-den-Leim-Geher, Georg Diez im Spiegel im Genaueren, zur Frage, ob der Herr Kracht eigentlich ein bissi ein Nazi sei. Doch die Frage „Nazi, oder nicht?“ stellt sich beim Kosmopoliten Kracht nicht, denn die Antwort ist einfach: natürlich nicht Nazi, dafür kommen die Deutschen in Imperium allesamt viel zu schlecht weg.
Und außerdem: Niemand kommt wirklich gut weg, in dieser abenteuerlichen Geschichte, welche von einem raunenden Beschwörer des Imperfekts erzählt wird. Am wenigsten der leichtfertige und kühlherzige Erzähler selbst. Sympathisch scheinen ihm die Menschen nur Momente lang. Doch auch hier wieder: Dieser Erzähler ist eine Figur und nicht Christian Kracht. Nächste Frage: Hat Diez das Buch eigentlich gelesen? Überlegte er auch, Krieger von Thomas D (auf dem Fanta-4-Album Lauschgift, 1995) als kryptofaschistische Hymne zu deuten?
In seiner Kolumne für Die Zeit notierte Roger Willemsen dazu: „Was hält den moralischen Rigorismus, die Polemik, das Scharfrichtertum des Rezensentenwesens eigentlich noch zusammen? Die Angst vor dem Schaden, den die Leserschaft nehmen könnte? Der Glaube an die Gefährlichkeit eines Mannes wie Christian Kracht? Ginge es um moralische Standards, ginge es um eine Vorstellung von der Welt, wie sie sein sollte, dann wäre dies humanistische Notwehr. Stattdessen bleibt nichts als Choreografie, Pas de deux, fingierte Gefahren, rhetorische Entzündungsherde, und deshalb ist, was zwischen Georg Diez und Christian Kracht verhandelt wurde, von antiquarischer Irrelevanz.“
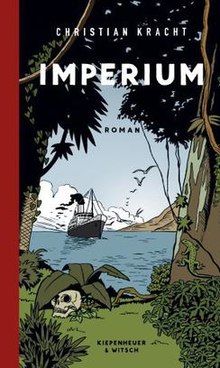 In erster Linie müssen wir Christian Kracht also als Stilisten und Satiriker sehen, in allerletzter Linie als Historiker oder Moralisten. Kracht nimmt subtil Unbehagen erzeugende Positionen ein, die auch meinem Empfinden nach punktweise problematisch sind, weil sie mich in meinem linksliberalen Harmoniebedürfnis stören, in meiner Vorstellung von der Welt, „wie sie sein sollte“. Das ist jedoch nur gut und recht, denn meine Strategien, inneren Konflikten aus dem Weg zu surfen, gehen mir selbst manchmal auf den Keks. Es braucht in meinem Denken einen wie ihn, auch wenn es sich unbehaglich anfühlt.
In erster Linie müssen wir Christian Kracht also als Stilisten und Satiriker sehen, in allerletzter Linie als Historiker oder Moralisten. Kracht nimmt subtil Unbehagen erzeugende Positionen ein, die auch meinem Empfinden nach punktweise problematisch sind, weil sie mich in meinem linksliberalen Harmoniebedürfnis stören, in meiner Vorstellung von der Welt, „wie sie sein sollte“. Das ist jedoch nur gut und recht, denn meine Strategien, inneren Konflikten aus dem Weg zu surfen, gehen mir selbst manchmal auf den Keks. Es braucht in meinem Denken einen wie ihn, auch wenn es sich unbehaglich anfühlt.
Daher fällt es mir schwer, die liebenswürdigen Seiten der öffentlichen Person Christian Kracht zusammenzusuchen, aber ich komme noch dazu. Einstweilen fallen mir kiloweise Meinungen und Beurteilungen von Kracht ein, besonders aus Interviews und aus seinen Feuilleton-Texten, die ich einfach nur unausgereift und ein bisschen dekadent finde, die mich in meinem Gerechtigkeitsgefühl aufstacheln und meinen Humanismus beleidigen.
Gleichwohl ertappe ich mich, wenn auch selten und meist spätnachts, beim Gedanken, dass die Erde ganz ohne uns Menschen ein schönerer Ort wäre; ein Ort, an dem nur ein Hase sich in einer endlosen Grassteppe schnuppernd aufrichtet. Auch wenn dann niemand mehr da wäre, der diese Erde als schön bezeichnen könnte. Diese Gleichzeitigkeit gegensätzlicher Welterfahrungen ist das erzählerische Terrain des Christian Kracht.
Mode und Verzweiflung
Überhaupt Tristesse Royale: Was waren das damals für emsige Beleuchter des Innenraums einer hohlen Welt, in der jemand wie der schlaue Utilitarist Ulf Poschardt als „Titan“ (Zitat, angeblich Kracht zuordenbar) durchgeht und der geistige Innenraumausstatter Tyler Brûlé als Lichtgestalt erstrahlt? Und so viel erlesene Großmannsucht auf einen Haufen, gleich einem gemeinschaftlichen Onsen-Bad in gefährlichem Halbwissen.
Von da ist es auch nicht mehr weit zu Benjamin von Stuckrad-Barre, seit dem Gruppenprojekt im Jahre 1999 berühmt als „das arrogante Arschloch mit den vier Hitlerjungen aus dem Adlon“ – sympathischer Weise eine, natürlich, wie könnte es auch anders sein, ironisierte Selbstbeschreibung. Aber wer Oasis ernsthaft mag, ja sogar als Lieblingsband verehrt, hat sich in den Fallstricken eines dreisten Retro-Marketings verfangen. So etwas endet wohl damit, down-and-out im Chateau Marmont zu sein. Panik unter Palmen. Das ist dann Pop, wahrscheinlich.
Tristesse Royale war eine ärgerliche Lektüre für viele Undankbare (die negativen Reviews standen damals circa 99 zu 1, und das lange vor gnadenlos-ehrlichen Amazon-Zeiten). Auch für die dankbareren LeserInnen war es streckenweise eine ärgerliche Lektüre, ein Schmetterling aus Kunstglas.

Wie oft wollte man Einhalt gebieten, auf unbotmäßige Vergleiche oder oberflächliche Bonmots hinweisen. Doch in der kurzen Zeit zwischen zwei Gedanken salbaderte sich schon wieder ein weiterer der fünf Popliteraten genussvoll in Rage – verwöhnte und zugedröhnte Von-und-Zus, die von mittelalten Mitte-rechts-Chefredakteuren als „Sprachrohr“ (auch so ein potenziell Krachtianisches Wort) der 90er-Jahre-Jugend erwählt wurden. Geahnterweise, um Gegengewicht zu schaffen: zum Afghanistan-Freund Willemsen etwa oder dem Mercedes-Stern-Verbieger Jan Delay. Ach, diese 90er, was sind sie bloß unwiederbringlich vorbei.
Das Quintett in einer Suite des Berliner Nobelhotels Adlon mit Blick aufs symbolträchtige Brandenburger Tor deutete die Phänomene der damaligen Zeit voll Pre-Millennium Tension, machte sich auf die Suche nach Bedeutung und fand dabei, als Zeichen der Götter, die verstaubte Hieroglyphe eines IWC-Schriftzugs.
Wie auch immer. Nur: Wer so kapriziös sich an geistiger Präzision festmacht wie Herausgeber Joachim Bessing und durch die Bret-Easton-Ellis’sche Kunst des weltstädtischen Namedroppings glänzen will, der hätte doch wohl für ein ebenso präzises Lektorat seines Gesprächs-Glamoramas sorgen können. Die Druckfehler in Tristesse Royale sind nämlich haarsträubend: von Roger Willemmsen (sic!) über Godards Au bout de souffle (eigentlich À bout de souffle) bis zur amerikanischen Lagerhaus-Marke „Carharrt“ (wohl eher Carhartt).
Nur wenige intellektuelle Gemeinschaftsmomente gab es in meinem Leben, aber dort Mitglied gewesen zu sein… da ließe ich mich lieber „nach einem Eimer Kartoffelsuppe anrülpsen“ (um Harald Schmidt zu zitieren). Was lernt der empathische Beobachter: Kokain trennt Herz und Hirn. Das auf gleicher Linie laufende Zitat des Austropoppers Boris Bukowski erspare ich mir, verlinke aber hyper-linkisch hier.
(Revision, Mai 2021: Ich habe Tristesse Royale nun nach mehr als 20 Jahren erneut gelesen und muss sagen, dass die meisten Analysen der Autoren akkurater und lustiger sind als ich sie in Erinnerung hatte und dass die Situation unserer Kultur nur noch kritischer geworden ist. So kann man sich irren. Nichtsdestotrotz lasse ich die oben formulierten Betrachtungen stehen, was die Leserin ob deren Vehemenz erstaunen mag. Aber wie man in Österreich sagt: Was liegt, das pickt.)
„Christian Kracht lebt und schreibt in Bildern“, schreibt Volker Weidermann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, „er verteilt immer neue Bilder von sich und lacht. Er beurteilt die Welt nach Lage der Bilder. Das macht auch die Schönheit seiner Prosa aus. Die Schönheit der Bilder, die er sieht, die er erschafft. Ist das moralisch?“
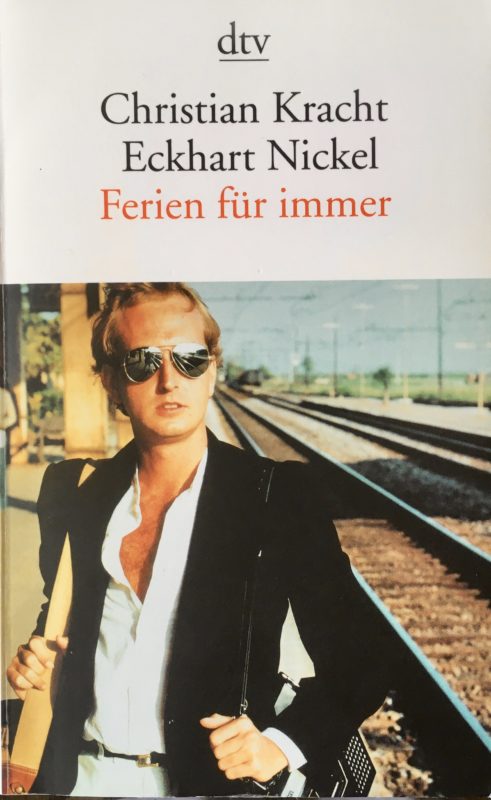 Weidermann weiter: „Ich muss da immer an eine sehr banale, sehr kleine Geschichte denken, die er in dem Gesprächsband Tristesse Royale einmal erzählte, über die Hässlichkeit der Kassiererinnen in Berliner Supermärkten, von denen viele keine Zähne mehr hätten („Die Physiognomien dieser Menschen sind so verkommen“) und er versucht bei seinen Gesprächspartnern in Erfahrung zu bringen, woran das liegen könne, „warum die Menschen hier so aussehen, wie sie leider aussehen“. Leider kann ihm keiner erklären, dass man in Deutschland, seitdem die gesetzlichen Krankenkassen Zahnersatz aus ihrem Leistungskatalog gestrichen haben, Armut meist zuerst an den Zähnen erkennt. Manchmal ist Schönheitsliebe und Hässlichkeitsverachtung einfach dumm und kalt und irgendwie selber hässlich.“ Touché.
Weidermann weiter: „Ich muss da immer an eine sehr banale, sehr kleine Geschichte denken, die er in dem Gesprächsband Tristesse Royale einmal erzählte, über die Hässlichkeit der Kassiererinnen in Berliner Supermärkten, von denen viele keine Zähne mehr hätten („Die Physiognomien dieser Menschen sind so verkommen“) und er versucht bei seinen Gesprächspartnern in Erfahrung zu bringen, woran das liegen könne, „warum die Menschen hier so aussehen, wie sie leider aussehen“. Leider kann ihm keiner erklären, dass man in Deutschland, seitdem die gesetzlichen Krankenkassen Zahnersatz aus ihrem Leistungskatalog gestrichen haben, Armut meist zuerst an den Zähnen erkennt. Manchmal ist Schönheitsliebe und Hässlichkeitsverachtung einfach dumm und kalt und irgendwie selber hässlich.“ Touché.
Stecktuch und Scheckbuch vom Papa, Entfremdung von dem, was Canetti unschön „Masse“ genannt hat, das sorgt naturgemäß auch für einen Mangel an Selbstachtung. So bewegte sich Christian Kracht first-class durch die Welt: voll Wehmut und Europamüdigkeit; feinfühlig und verschreckt, gottverlassen und mutterseelenallein; an der eigenen Herkunft ebenso leidend wie an der Resonanz der Mitmenschen darauf. Sein Werk voll Ambiance und Ambivalenz. Auch eine lange schon kultivierte Angstlust liegt darinnen.
Notgedrungen muss er sich ungreifbar, unnahbar geben. Er ist ein spirituell Obdachloser, ein Verwirrter, Verlorener – wie wir alle es sind, im kapitalistischen Weltzerstörungswahnsinn. Man weiß letztendlich nie, ob er gerade inszeniert oder authentisch ist. Die Trennlinie scheint auch dem Autor Nahestehenden eine problematische zu sein, möglicherweise sogar ihm selbst. Mir kommt vor, der sanftmütige, beinah verschüttet wirkende Mensch Christian Kracht muss manchmal dafür gerade stehen, was der wesentlich härtere und extremere Provokationskünstler Christian Kracht ihm so alles eingebrockt hat.
Politisch ist er vermutlich am ehesten in der Mitte zu verorten; in manchen wirtschaftspolitischen Fragen vielleicht ein bisschen rechts davon, in manchen gesellschaftspolitischen Fragen etwas links davon. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Grundsätzlich dürfte ihn als Ästheten die Politik vor allem – langweilen.
Für Kracht mag jene Beschreibung gelten, mit der sich der Publizist und Verleger Fritz J. Raddatz (1931 – 2015) belieh: „Ich habe nie in eine dieser Schubladen gepasst. Weil ich Maßanzüge trug, war ich deswegen noch nicht Mitglied der CSU. Weil ich mit den Studenten zum Teil auch zusammen gearbeitet habe, war ich deswegen noch kein Rollkragenpullover tragender Revoluzzer. Das hat immer Unruhe gestiftet, weil man sich immer fragen musste: Wer ist er denn eigentlich? Wo gehört er denn nun hin?! Ich kann nur sagen: Ich gehöre zu mir und bin meinen Weg gegangen.“
Unter Snobs: Brennen muss Salem!
Scham, Schuld und Demütigung. Dies seien Schlüssel-Sentiments seines literarischen Weges, gab Christian Kracht 2018 bei seiner Frankfurter Poetikvorlesung freimütig bekannt. Daher auch sein verhaltenes Sprechen. Gleich erwächst mir ehrliches Mitgefühl mit dem so Bedrückten, musste ich selbst auch so manch klamme Minute in der schweißheißen Achselhöhle eines Bauernjungen in der Volksschule (die österreichische Version der Grundschule) zubringen, der dem „reichen“, „zugereisten“ Kind die Kraft des Landes spüren hatte lassen, im Schwitzkasten, der nach Stall und fremdem Waschmittel roch, während die Mädchen im Kreis umherstanden und applaudierten.

Dass Kracht an der Welt und an seiner Vergangenheit leidet, war ja nicht zu übersehen. Bis er in einem Interview mit dem SRF meinte, er empfand in seiner Schweizer Kindheit den Aufruf seines Vaters, den benachbarten Bauern beim Heuen zu helfen „als Erniedrigung“.
Eine Unerhörtheit für mich, der ich nicht nur ein leidenschaftlicher Heuhelfer in meinem heimatlichen Tirol bin (Der Duft! Die gemeinsame Aufgabe! Das brunnenkalte Bier danach!), sondern in dieser sehr körperlichen, sehr beschwerlichen Arbeit auch eine dankbare Verneigung vor dem vorbildlichen Landleben des großen John Berger sehe. Vielleicht auch, weil ich mich wie Ljewin in Anna Karenina dabei nicht fragen muss, wozu ich eigentlich da bin. Das Heu muss ganz einfach auf den Heuboden bevor der Regen kommt.
Kracht funktioniert da eben ganz anders und scheint schon als Kind ein kleiner Lord gewesen zu sein. Ein im anglikanischen Internat von einem teiggesichtigen Pastor namens Keith Gleed missbrauchter kleiner Lord allerdings, wie sich in ebenjener Frankfurter Poetikvorlesung herausstellen sollte. Damit ist keine meiner wenigen negativen Kindheitserfahrungen vergleichbar und es tut mir sehr leid, dass Kracht so etwas Entsetzliches durchmachen musste. Bereits in Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten hat dieser „Padre aus der kanadischen Dominion“ beinahe unbemerkt Einlass gefunden, hat ihn sich Kracht zwar nicht von der Seele geschrieben, aber in sein Werk eingebracht.
Eine weitere äußerst unangenehme Figur in seinem Schaffen ist Maximilian Sandberg aus Krachts Drehbuch zu Finsterworld (2013). Ist Maximilian einer jener Schüler, unter deren verrotteter Ägide Kracht einst in der Privatschule Schloss Salem am Bodensee hat leiden müssen? Oder ist er der filmische Pappaufsteller des Drehbuchautors für sein eigenes Image in der ironiefreien Zone bundesdeutscher Öffentlichkeit? Die Figur dieses Maximilian hinterlässt nämlich eine beredte Stille nach der großen, großen Frage der Deutschen: „Wer sind wir?“ Eine Frage, auf die es neben den Antworten „Papst“ und „Weltmeister“ einige weitere, nicht so großartige gibt.
Maximilian Sandberg ist genau der Typus, der in manchen Szenarien meiner Kitzbüheler Jugend in irgendeinem Party-Chalet auftaucht, (manchmal tatsächlich ein „Maximilian“), ein Schnösel mit finanziell gesicherter Ruhe im Blick, der den Münchner Kindeln ihr Koks wegschnupft und folglich unter der Hirschgeweihsammlung des längst suizidierten Hausbesitzers post-post-ironisch das Horst-Wessel-Lied todernst und textsicher, aber im Micky-Maus-Falsett vorträgt.
A German Ghost Story
Undurchsichtig schillernd wie ein Fabergé-Ei, düster und undurchdringlich wie Grimmsches Unterholz sind Christian Krachts Erzählungen, rätselhaft wie eine Blutspur auf Eichenlaub. Alle seine Romane sind im Grunde eines: Geistergeschichten, Storys über Charaktere, die im Verschwinden begriffen, der Handlung abhandenkommen, ja, gar nicht wirklich vorhanden sind.
Faserland (1995), sein Erstling, macht da keine Ausnahme und ist in meinen Augen sein unangenehmstes Buch, eine Art deutscher Fänger im Roggen, der jedoch niemanden davor bewahren konnte, über den Rand des Feldes hinauszulaufen und über die Klippen abzustürzen – ganz im Gegenteil. Faserland fällt für mich am meisten aus der Reihe seiner Werke und ist vor allem: peinigend traurig.
 Um den Kardinalfehler der Verwechslung zwischen Autor und narrativem Ich zu vermeiden: Genauso wenig wie Kracht der Erzähler von Faserland ist, waren die tristen Sauf- und Koksveranstaltungen in Faserland „Party“. Ich habe nie verstanden, was an diesem Buch so typisch für die Partys der 90er Jahre hätte sein sollen. Doch schließlich war mein zweites Wohnzimmer von 1995 bis 2001 ein Nachtclub: das FLEX am Donaukanal, ein Ort der Solidarität, des Wiener Schmähs und des dicken Basses.
Um den Kardinalfehler der Verwechslung zwischen Autor und narrativem Ich zu vermeiden: Genauso wenig wie Kracht der Erzähler von Faserland ist, waren die tristen Sauf- und Koksveranstaltungen in Faserland „Party“. Ich habe nie verstanden, was an diesem Buch so typisch für die Partys der 90er Jahre hätte sein sollen. Doch schließlich war mein zweites Wohnzimmer von 1995 bis 2001 ein Nachtclub: das FLEX am Donaukanal, ein Ort der Solidarität, des Wiener Schmähs und des dicken Basses.
Den traumatisierten Burschen in der Barbourjacke hätte ich damals, hart am Hard Rock und Dub Reggae, geflissentlich übersehen, und wäre er mir auch stundenlang im Zug gegenüber gesessen. Hätte er jedoch Tintin (Tim und Struppi) gelesen, so wären wir sicherlich miteinander ins Gespräch gekommen.
So wie Kracht seine narrativen Tableaus, seine weitläufigen Wortlandschaften und sogar einige seiner Buch-Cover nach dem Zeichner Hergé gestaltet, ist die Erzählstimme gerade in Der gelbe Bleistift (2000) ein wenig nach Truman Capotes Städteporträt-Sammlung The Dogs Bark modelliert: das Neugier weckende „wir“ der Erzählerstimme, das Raffinement der Wahl, das reiche Reiseleben.
x
„Ich denke daran, … dass ich diese Stunde, in der das Licht nachlässt und man aufnahmefähiger wird für ganz komische Dinge, wunderbar finde.“
– aus Faserland
Das macht ihn mir sympathisch, denn ich mag Capote seit jeher. Doch muss man einen Künstler, dessen Werk man schätzt, überhaupt persönlich sympathisch finden? Würden folgende Damen und Herren unangekündigt zum Tee zu mir kommen, wären sie mir als Gesellschaft angenehm? Hermann Hesse, Isabelle Huppert, Lou Reed, Norman Mailer, Chuck Berry, James Joyce, F. Scott Fitzgerald, Faye Dunaway, Bryan Ferry, Nicolas Windig Refn?

Sensible Menschen können ganz schön dünnhäutig sein, und feinnervig. Manchmal wohl auch einfach nur nervig. Das schließt mich selbst ganz sicher ein. Das Feinfühlige, das Schwerlidrige, aber auch das Schwermütige sieht man Kracht bereits auf seinen Kindheitsfotos an, die er ab und an auf Instagram veröffentlicht.
Andererseits: Sensible Menschen können auch meist nicht anders. Man kann ja nicht von einem Tag auf den anderen weniger sensibel werden. Die dicke Haut, sie wächst nur langsam. An allem und jedem sehen Sensible die Spuren des nahenden Untergangs der Menschheit — oder zu ihrem Missfallen, zu wenige!
Dazu der Schweizer Autor Fritz Zorn in seinem einzigen wie einzigartigen Buch Mars: „Ich glaube zwar nicht, dass die Sensibilität etwas Minderwertiges ist, bin aber der letzte, der es – wie es in bürgerlichen Kreisen gern geschieht – beglückend findet, wenn man von einem Menschen sagt, dass er ein sensibler Typ sei. Schiller hat in seinem Essay über das Naive und Sentimentalische schon bewiesen, dass das Sentimentalische für den einzelnen zwar sehr unangenehm sein kann, für die Gesellschaft aber etwas äußerst Wichtiges darstellt. Ich möchte noch weitergehen und darauf aufmerksam machen, dass die Sensibilität für den Betroffenen oft sogar ein großes Unglück bedeutet und dem sensiblen Menschen viele Leiden, aber kaum Freuden bereitet.“
Der feinfühlige Christian Kracht flirtet wohl mit Understatement, wenn er sich selbst „als schlechtesten Journalisten von allen“ beschreibt. Wie gut für ihn, dass er dafür als Romancier brilliert.
Als Indien-Korrespondent des Spiegel (in der Nachfolge des großen Tiziano Terzani, dem jeglicher berufliche und soziale Snobismus fremd war) ist Kracht jedenfalls fragwürdig: Als im Spätsommer 1997 Mutter Teresa stirbt, erhält er die Meldung von einem Mitarbeiter des Magazins und wird mit einem Nachruf beauftragt.
Er hätte, so heißt es im Kapitel „Die Tempojahre“ im Reader Grenzgänger, (Hg. Pörksen/Bleicher), die Nachricht bekommen, „als er gerade auf seiner Terrasse in Neu-Delhi eine Tasse First-Flush-Broken-Orange Pekoe genoss“. Kracht habe sich so gestört gefühlt, dass er den Tee zu lange ziehen ließ. „Weil der Tag daraufhin im Eimer war“, beschloss er, die Hauptredaktion nicht zu informieren und den Tod der Sterbehaus-Betreiberin und Nobelpreisträgerin zu ignorieren. Dies blieb natürlich nicht unbemerkt und so trennte man sich von dem Korrespondenten mit seinem Desinteresse an den Konventionen der Themenselektion und den Spielregeln des Journalismus.
„Heute ärgere ich mich“, so wird Christian Kracht zitiert, „über diesen plumpen Versuch, das große Nachrichtenmagazin auszutricksen.“ Mein Verdacht ist, dass es ihm unüberbrückbar langweilig erschienen sein muss, der charakterlich herben, erzkatholischen Mazedonierin ein Denkmal zu setzen.
(Inzwischen hat mich eine elektronische Epistel von Kracht erreicht, wonach es sich dabei um einen Jux gehandelt habe, den sich Terzani und er auf besagter Terrasse ausdachten. Anm. 2023)
Ähnliches weiß Fabian Dietrich in der Zeitschrift für elektronische Lebensaspekte De:Bug zu berichten. Vor allem für Krachts metaphysisches Reportagen-Kompendium New Wave (2006) gelte die Faustregel: „Je abgründiger ein Land, desto wahrscheinlicher ein Besuch von Christian Kracht. Krisenregionen, Schurkenstaaten, Wahnsinn und Katastrophen sind allerdings selten das eigentliche Thema eines Textes, sondern meist nur dessen Rahmen. Wichtig sind erst mal die kleinen Dinge, die Oberflächen, die Menschen, das, was gesagt wird und passiert.“
Umerziehungs-Camp
Der heimliche Wunsch, einen Mönch zu vergiften, löste bei Umberto Eco die Niederschrift des Mittelalter-Krimis Der Name der Rose aus. Christian Krachts Roman 1979 mag der Wunsch zugrunde gelegen haben, einen in Dekadenz orientierungslos gewordenen Partyparasiten unter die Pranke eines autoritären Systems zu scheuchen, wo dieser seinen (ewigen) Frieden findet. Wie ein Zebra aus einem bankrotten Zoo wird die Hauptfigur in die Wildnis hinausgetrieben. Als statuiertes Exempel der notwendigen Züchtigung des allzu Zierlichen, die ihm in der zivilisatorischen Verweichlichung von heute angebracht scheint?
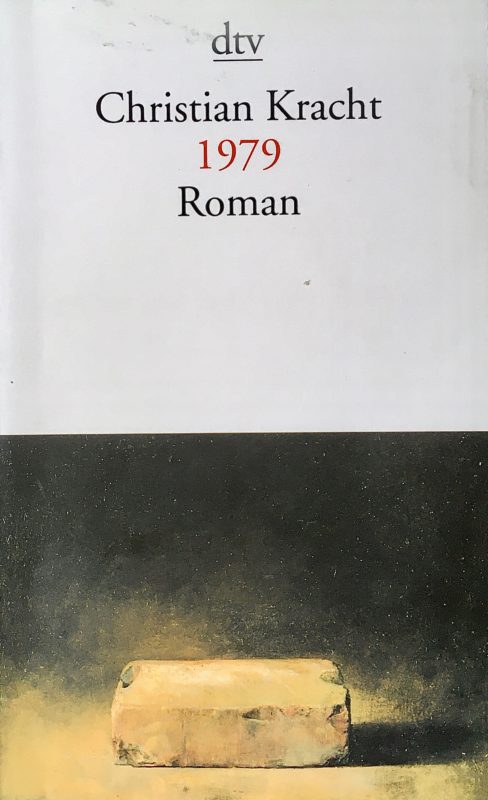
Die Kultiviertheit der Reflexion in Wort und Schrift vergeht einem womöglich, wenn man einmal das letzte Tabu gebrochen hat, nämlich Menschenfleisch zu essen. 1979 ist ein durchaus grausamer Roman über die Unvermeidbarkeit der Unterwerfung und über die Unterwerfung als Schutzsuche. Dieser Roman stellt erneut die Frage der Sex Pistols: Who Killed Bambi? Und er ist verdammt schwer aus dem Kopf zu kriegen.
Was ist Kracht der Krieg? Möglicherweise ein reinigendes Stahlbad, ein „Gebirgsfluss unter dessen Eis man gestoßen wird“, die Ernüchterung einer eingezäunten Spaßgesellschaft, die Ver-Ernst-Jüngerung einer ganzen Generation von einstigen Fix-und-Foxi-Lesern oder ein Rammstein-Gewitter, welches über Kruder-&-Dorfmeister-Hörer hereinbricht. Aber weiß Christian Kracht aus Erfahrung am eigenen Leib und an eigener Seele, wie unfassbar tatsächliche Militärgewalt ist, wenn sie nicht bloß eine ästhetische Erfahrung ist?
So erzählt er (in einem Kanalisationssystem und als sein Comic-Alter-Ego Tintin kostümiert) im Gespräch mit dem von ihm hingerissenen Denis Scheck von den politischen Gründen, die ihn bewogen haben, jüngst nach Argentinien zu ziehen: Die Falklandinseln müssten neu ausverhandelt werden. Wenn es Not tue, auch mit Waffengewalt. Hört, hört.
Auf Schecks Frage, ob er die militärische Bewegung anzuführen gedenke, antwortet der Autor umgehend und seine Fassade freundlich zerbröseln lassend, dass er dafür, wie jeder Politiker, natürlich viel zu feige sei. Wo soll das hinführen? Gute Pose, aber leider schnell aufgegeben.
Wohl kalibriertes Gift durchfließt das Aderwerk der Krachtschen Romane: Blutegel, die aus Nasenlöchern gezogen werden, nässende Ausschläge und mit der Pinzette ausgezupfte Wimpern. Detailliert geschilderte Grausamkeiten, Hippie-Hass und Ekel-Kitsch finden sich auch in Ferien für immer (1998) sowie in seiner Sammlung von Reiseerzählungen aus Asien, Der gelbe Bleistift, der eine Kolumne in der Welt am Sonntag vorausgegangen war. Manche seiner Sätze sind langsam zur Erde stäubende Kerosinwolken eines Überfliegers, andere irisierende Irrlichter eines Illusionslosen.
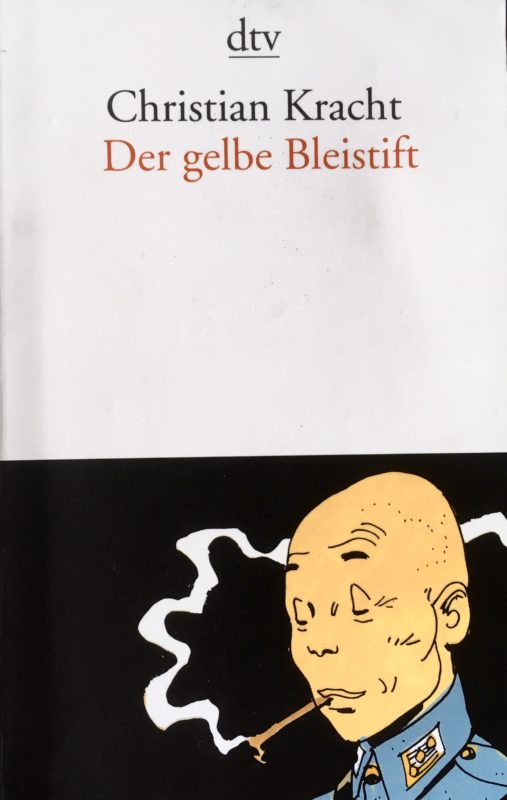
Christian Kracht selbst ist immer nie da. Er ist der vanishing actor, stets unterwegs zum grünen Leuchten draußen am Wasser vor Long Island. Seine Kunst ist die des Verschwindens, wie sie nur der unsterbliche Seemann Corto Maltese beherrscht. Während sich die geschwätzige Intelligentsia noch wundert, wie er dies oder das wohl gemeint habe, sieht man nur noch seine Mantelschöße davonschweben, zurück ins Mysterium.
So sind auch Krachts öffentliche Auftritte als vorübergehende Belebungen eines ansonsten leeren Platzhalters zu deuten. Ähnlich wie im Fall des verweigerten Mutter-Teresa-Nachrufes gilt: He can’t be bothered. Es wäre ihm körperlich unangenehm, eine eindeutige, möglicherweise sogar pathetische Haltung einnehmen, eine „Gutmenschengesinnung“ an den Tag legen zu müssen.
The Magic Christian: Zauberkunst der Atmosphären
Kracht polarisiert. Nicht wenige Leserinnen und Leser seiner bislang sechs Romane beschlich ein Gefühl: Fand man an der Lektüre Gefallen, so konnte man sich des nagenden Verdachts nicht erwehren, man sei einer Trickkiste aufgesessen. Und wenn nicht, so hatte man wahrscheinlich etwas nicht verstanden, was einer großen Leserschaft offensichtlich großen Genuss verschaffte. Aber was?
Und was da so als Blurbs auf seinen Bucheinbänden von namhaften Kollegen und Kritikern zu lesen ist, muss wohl das größte Amüsement für Christian Kracht sein. Wiederum springt er als vorübergehende Belebung eines Platzhalters ein, wenn die Gegenwart den ihr gemäßen grand auteur sucht. Mit all seinen Trickster-Posen und literaturhistorischen Versatzstücken, seiner „überkokett kultivierten Weirdness“ (©Rainald Goetz) ist Kracht vielleicht vom poetischen Rang, von der humanistischen Haltung her gar nicht der Autor seiner Generation.
Stellt sich die Frage: Verdient unsere Zeit das überhaupt? Eine Zeit der zerbrochenen Maßstäbe, in der alles und das Gegenteil davon wahr zu sein scheint? In diesem Sinn ist Christian Kracht genau der Autor, der perfekt für unsere Epoche der Uneindeutigkeit steht: der Romancier der Verunsicherung, der Erzähler einer doppel-und-dreifach-bödigen, aber eigentlich bodenlosen Realität.
Claude D. Conter merkt in seinem Essay über posthistorische Ästhetik an, dass die Vorstellung vom Verschwindenwollen aus der (oft in der Katastrophe mündenden) Menschheitsgeschichte kaum andernorts so gegenwärtig ist wie in Krachts Werk. Seine winterlich-wunderliche, vom Steampunk angetriebene Dystopie Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten sei gar „eine Phänomenologie des Verschwindens“.
x
„Wir können die Identität dieses Autors nicht überprüfen, es ist möglich, dass es sich um keine berühmte Person handelt – uns fehlt eine genauere Information über den Autor.“
Quelle: www.beruhmte-zitate.de/autoren/christian-kracht/
Auch in Tristesse Royale erhofft Kracht sein eigenes „Verschwinden bis zum Nullpunkt“. Und sogar die Unstetigkeit seiner Lebensmittelpunkte ist eine Aneinanderreihung von Auslöschungen seiner Präsenz an den jeweiligen Orten: Bangkok, Florenz, Buenos Aires, Lamu, Los Angeles, Landour. Ein weiteres Kracht-Phantom soll unlängst gesichtet worden sein, als es, in einen karierten Schal gewickelt, über das schottische Hochland huschte.
Am liebsten würde er wohl, wie Vladimir Nabokovs Martin in Glory (Die Mutprobe), im Aquarellbild eines dichten Waldes verschwinden, zwischen den Baumstämmen, über einen dunklen Pfad in malerischen, geheimnisvollen Windungen.
Doch ganz anders als Nabokov, dem seine politische und soziale Außenwelt eher egal war – mit seiner Véra, den Marmeladengläsern und den Schmetterlingen –, reibt sich Kracht an seinem Publikum. Er leidet an ihm, verachtet es ein wenig und fürchtet sein Verdikt. Dafür verführt und verwirrt er es im Spiegelkabinett der Identitäten.
Zeugnis hierfür sind sein mittlerweile aus der Internet-Öffentlichkeit verschwundenes Porträt mit Kalaschnikow oder seine jüngsten Autorenfotos, fotografiert von einem gewissen „Anthony Shouan-Shawn“ (nicht verifizierbar) oder von seiner Frau, die ihn zerzaust vom wilden Wind des Weltentaumels zeigen. Er ist ein Verwandlungskünstler wie David Bowie, der sich von höchst unterschiedlichen Einflüssen inspirieren lässt. Denn alles, was ein schreibender Mensch mit den Sinnen aufliest, kommt bei den Fingerspitzen wieder raus.

Krachts Genre-Blaupausen und Samplequellen waren je nach Bedarf seiner jeweiligen Projekte: Bret Easton Ellis, Robert Harris, Joseph Conrad, Philip K. Dick, Evelyn Waugh, W. Somerset Maugham, William S. Burroughs und Paul Bowles. Gekonnt channelt er auch Hugo Pratt, Erich Kästner, Friedrich Dürrenmatt, Robert Byron oder Abe Kōbō. Niemand kann das so gut wie er.
Nicht nur deswegen wird er als weltliterarisch bedeutsam wahrgenommen und weiß sich auch dementsprechend publizistische Anwesenheit zu verschaffen, am obersten Sonnendeck des Elfenbeinturms.
Dort steht ein schmaler Mann mit honigfarbener Haartolle in einem weißen Anzug aus Hongkong. Er trägt ehrlich niederspazierte Desert Boots an den Füßen und die Hände hält er hinter dem Rücken verschränkt. Dann zündet er sich „umständlich“ eine Parisienne an, während sein verkniffener Blick den Turnerschen Streifen eines gelben Horizontes mustert. Der Himmel darüber ist finster gestimmt. Ist es Kracht? Er könnte es sein. Doch beim Näherkommen löst sich die abgewandte Gestalt in Licht auf und verschwimmt mit dem geheimnisvollen Leuchten zwischen Himmel und Meer.
Un vero scrittore
So sind die Bücher dieses rätselhaften Schriftstellers als Pasticcios zu lesen, als glimmende Zitat-Höllen des Hipstertums, als virtuoses Vexierspiel der Autofiktionalität, als Flucht vor der Rezeptionstreibjagd. Jedes seiner Werke könnte stilistisch von einem anderen sein, fast wie bei Bowie.
Doch muss das Werk eines Künstlers einen „Kern“ haben? Muss eine Persönlichkeit einen „Kern“ haben? Einen Wesenskern oder kleinsten gemeinsamen Nenner aus Atem und Bewusstsein wie das hinduistische Konzept des Atman? Oder sind wir alle nicht eher, Buddhaghosa und auch Richard David Precht zu Folge, oszillierende Gravitationsfelder von Vorbildern, Vorlieben, Animositäten und Ansichten? Und: Wie viel müssen wir überhaupt über einen Autor wissen? Der Autor muss ja schließlich auch nichts über den Leser wissen.

Zum Erscheinen seines ersten Buches Faserland vagabundierte Kracht lieber kreuz und quer durch Indien als sich der Biederkeit der deutschen Medienwelt zu stellen. Es ist ja auch nicht seine Pflicht und verdient allein für diese Verweigerung vollen Respekt. Kracht als internationaler Literat ist jedenfalls bis heute dem deutschen Kulturbetrieb viele Flugmeilen weit voraus.
Dennoch, so scheint mir, traut Christian Kracht seinem eigenen Erfolg nicht ganz. Vielleicht stellt sich ihm die (nicht ganz unberechtigte) Frage, ob er seinen literarischen Flugschein aus ganz eigenem Antrieb gemacht hat, oder ob seine Karriere als Journalist und Autor nicht vom einflussreichen Vater auf die Startbahn gelenkt worden ist.
Ein Hinweis auf dieses Impostor-Syndrom findet sich auf Seite 51 in Faserland, wo der namenlose Erzähler berichtet, dass er schon als Kind gern geflogen sei, „weil er das Gefühl der Wichtigkeit liebte, das Reisende umgab“.
Auf den vielen Flügen nach Italien, wo die Eltern ein Haus gehabt hatten, sei er von den Stewardessen „wie ein kleiner Prinz“ behandelt und von den Alitalia-Piloten ins Cockpit gelassen worden: „… dort durfte ich den Steuerknüppel halten, obwohl ich schon damals wusste, dass die Piloten auf Automatik geschaltet hatten, ich also das Flugzeug nicht ganz alleine flog, wie die Piloten mir ständig versicherten. Si Si, haben sie gesagt, du machst das wie ein großer, ein richtiger Pilot. Come un vero pilota. (…) Ich habe es mir nie anmerken lassen, dass ich die Wahrheit wusste: Es ist nur der Autopilot. Schließlich waren sie alle sehr nett zu mir.“
Ganz ähnlich zweifelt Kracht in manchen Interviews an seinem Status als Autor und denkt laut darüber nach, ob seine Romane nicht in Wirklichkeit nur Simulationen von Romanen seien und er eben nur ein Schriftsteller-Darsteller.
Dieser Knick im Selbstwert tritt dann auch in seinem zuweilen erschreckend schüchternen Verhalten bei den Preisverleihungen für ebendiese Romane zutage. Schließlich kam es ja schon vor, dass Kracht anstatt eine Dankesrede zu halten, ins Hotelzimmer floh und sich dort verbarrikadierte, gerade weil bei der feierlichen Anerkennung seines Erfolges „alle sehr nett“ zu ihm waren.
Aber nach mehr als 25 Jahren im Literaturbetrieb und nach mehr als zehn teils internationalen Auszeichnungen und Würdigungen könnte Kracht doch eigentlich wirklich selbstbewusster zu seiner Arbeit stehen und sich selbst Anerkennung schenken: als richtiger (und nicht nur meiner kleinen Meinung nach) wichtiger Schriftsteller ohne väterlich-Springerschen Autopilot, nicht bloß come un vero scrittore.
Durchsichtige Dinge
Auf semantischer Ebene ist es einfacher, an der Oberfläche von Christian Krachts Texten auszurutschen, als in deren Tiefe zu ertrinken. Dazu ist das Exterieur einfach zu stabil, das Eis zu dick. Das Gefühl der Tiefe darunter schenkt bloß wohligen Schauer. „Oberfläche ist eine Illusion, doch auch Tiefe ist eine Illusion“, sagt David Hockney in A Face by Rossetti, a Face by Manet und Oscar Wilde warnt in der Vorrede zu Das Bildnis des Dorian Gray: „Wer unter der Oberfläche gräbt, tut es auf eigene Gefahr.“
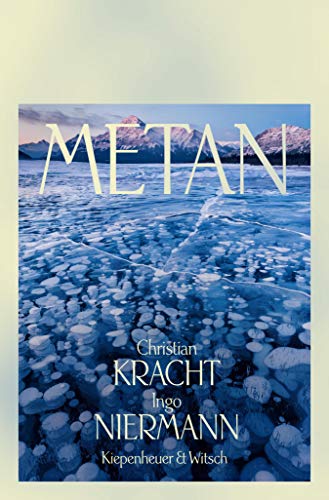 Genau das ist das Schöne an Comics, insbesondere an ligne-claire-Comics wie Tim und Struppi: die flächige und oberflächliche Vereinfachung der komplexen Lebenswelt der Moderne. Noch Minuten oder Stunden nach deren Lektüre sieht man die Welt in dieser schattenlosen, tröstlichen Optik.
Genau das ist das Schöne an Comics, insbesondere an ligne-claire-Comics wie Tim und Struppi: die flächige und oberflächliche Vereinfachung der komplexen Lebenswelt der Moderne. Noch Minuten oder Stunden nach deren Lektüre sieht man die Welt in dieser schattenlosen, tröstlichen Optik.
Heute Vormittag war Der Fall Bienlein meine Lockdown-Lektüre. Und gerade eben habe ich aus dem Fenster geschaut und einen älteren Herren seinen Hund spazieren führen gesehen. Keinen älteren Herren, der womöglich zu Hause seine Frau prügelt, der mit seiner Tochter Sex hat oder im Keller Hitlerbilder sammelt. Sondern eben nur einen älteren Herren, der seinen Hund spazieren führt. Ganz gemütlich. Sogar der Hund: ganz gemütlich drauf. Es war wie in einer Zeichnung von Hergé und es war gut.
Was gefällt mir noch an Kracht, nun da ich tatsächlich ins Schwärmen geraten bin? Das, was ihn mit Roland Barthes, Rainald Goetz, Eckhart Nickel, meinetwegen auch mit Stuckrad-Barre eint: die Lust am Text. Ich sehe ihn vor mir, der Literatur beinah religiöse Würde erweisend und die Dichtung mit seinen Weggefährten feiernd wie der Zeremonienmeister eines geheimen Pennälerzirkels – des Nachts am Friedhof bei Kerzenschein, mit handlichen Bänden von Shelley, Keats und Hölderlin sowie einer Flasche Drambuie.
Weltliteratur ist sein inneres, aber auch sein äußeres Exil, sein Trost – siehe seine Buch-Installationen auf Instagram. Bei der physischen Gestaltung seiner Textkörper scheinen ihm seine Verlage eine Menge Mitspracherecht einzuräumen. Das Ergebnis: eine subtile und schlüssige Wechselwirkung von Inhalt und Form – Bücher als objets de désir mit Titeln wie sie ein Parfümeur als Namen exquisiter Duftnoten kreieren würde. Christian Kracht liebt Bücher und man kann von ihm eine ganze Menge über die Literatur lernen, auch wenn er im Sinne von Rancière ein „unwissender Lehrmeister“ sein mag. Und in der stroboskopischen Bezugnahme auf vorhergegangene Dichtung und Geistesgeschichte erweist sie sich schließlich: die Tiefe, oder vielmehr blitzhafte Eindrücke von Tiefe, die unter die schimmernden Oberflächen seiner Texte hineinversteckt sind und nur durch wissendes Zutun des Lesers aus dem Nachtblau heraufschillern.
Die musikalische Analogie wäre der Dub Remix, aus dessen Echo-saturierten, schwummrigen und schummrigen Weiten Sample-Schnipsel des Originals auftauchen. So wie der erste Satz von Imperium, der in seiner Struktur den ersten Satz von Hesses Siddhartha evoziert. Oder wie der lila Bleistift aus Nabokovs Schweiz-Roman Durchsichtige Dinge, der in Die Toten immer wieder auftaucht und den die Hauptfigur Emil Nägeli auf wundersame Weise am Boden eines japanischen Taxis wiederfindet, aufliest und so lange bei sich behalten will, „bis er darauf komme, was gemeint gewesen sei.“
Der temporeiche, ironische Dandy von Springers Gnaden ist nur als Medienfigur ein solcher. Ob er es tatsächlich ist, bleibt zu vermuten, denn ich kenne Christian Kracht nicht persönlich. Seine Weltsicht aber ist tatsächlich nur oberflächlich oberflächlich. Er verweigert sich bloß der allzu ernsten und tiefen Verbeugung vor der Bedeutung des Tiefsinnigen, denn gerade das Schürfen nach dem Tiefsinnigen hat enormes Leiden über den Einzelnen und die Vielen gebracht.
x
„Alles, was sich selbst zu ernst nimmt, ist reif für die Parodie.“
– aus Emigration: Frankfurter Poetikvorlesung
Deshalb Met(h)an als gasförmiger Weltgeist, Vril als Energiequell allen Lebens, die „große Pyramide“ als himmelragende Antwort auf alle Fragen der Bestattung, deshalb auch die Jagd nach dem mystischen Boodhkh in den Weiten der Mongolei.
Sogar seine Autorenbiografie auf der Innenklappe verfasst er als ironisches Kunstwerk („In Saanen in der Schweiz kam Christian Kracht 1966 zur Welt. Er ist 1,75 m groß, …“). All diese kapriziösen Eitelkeiten, all dieser Gegenwartsüberdruss, all dieses Wissen um die korrekte (literarische) Etikette und deren bewusste Brechung wären natürlich unerträglich, wäre Kracht noch dazu ein vollendeter Schriftsteller. Dies ist glücklicherweise nicht der Fall, und das macht ihn mir noch sympathischer: Christian Kracht ist zwar ein literarischer Zauberkünstler, aber noch kein Meisterschriftsteller.
In Die Toten etwa versteigt er sich sprachlich einige Male: Die Zusammensetzung Gletscherski-Urlaub in Kapitel 5 legt nahe, es gäbe so etwas Spezielles wie Gletscherski. Gibt es aber nicht, also müsste die korrekte Trennung der Substantivkette Gletscher-Skiurlaub heißen.
In Kapitel 12 findet sich der Satz: „Dem Jungen war nun jener kleine, scharfe, kneibelnde Hasenmund jede Nacht im Traum erschienen“. Kneibelnd ist hier das onomatopoetisch absolut treffende Wort – welches mir davor unbekannt war. Scharf ist jedoch nicht der Mund (in der Sprache des Jagens eigentlich das „Geäse“) des Hasen, sondern wohl eher seine Zähne.
In Kapitel 18 hat Nägeli Sex mit Ida: „… ihm war dabei, als habe Ida, ihm ab- und der Wand zugedreht, ein lautloses Gähnen unterdrückt.“ Es müsste aber heißen: „… von ihm ab- und der Wand zugewandt…“, denn ausgeschrieben wäre „ihm abgedreht“ zumindest holprig, wenn nicht gar schlichtweg falsch.
Im Kapitel 23 legt Kracht dem niederträchtigen Grobian Putzi Hanfstaengl bei dessen Satz „…man werde sich jetzt, bitteschön, etwas vergnügen zu dritt in Berlin“ ein „dunkel oberbayrisches, zäpfchenträllerndes R inmitten Vergnügen, dritt und Berlin“ in den Mund. Dies ist bei genauerer Analyse jedoch unpräzise. Das bayrische R wird am vorderen Gaumendach gerollt und nicht im Rachen, wo das Zäpfchen hängt, und: Ein Bayer würde zwar das R bei dritt rollen, jedoch nicht bei Vergnügen und Berlin.
Und was hat es mit dem Zeitwechsel ins Präsens auf sich, der sich von Kapitel 21 auf Kapitel 22 ereignet? Wieso gerade dort und nicht schon zu Beginn des zweiten Teils? Ist das Bequemlichkeit, Willkür oder kann mir bitte irgendwer dessen erzähltechnische Bedeutung erklären?
Mir sind noch ein halbes Dutzend (!) weitere fragwürdige Punkte zu Die Toten aufgefallen, die ich mir hier aus Platzgründen schenken werde. Ganz schön viel für einen Roman, der in zwei der renommiertesten deutschen Verlagshäuser erscheint, mit dem Hermann-Hesse-Preis und mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet, von der Stiftung Pro Helvetia finanziell unterstützt und in der ARD-Sendung Druckfrisch als „Revolution des Romans, ähnlich wie der Tonfilm für das Kino“ gefeiert wurde. Wäre ich auch Romanschriftsteller, vielleicht sogar ein mittelloser, würde mich das, gelinde gesagt, dazu bringen, mich in den Arsch zu beißen – wenn nicht gar vom Buchstaben K am KiWi-Verlagsgebäude zu springen.
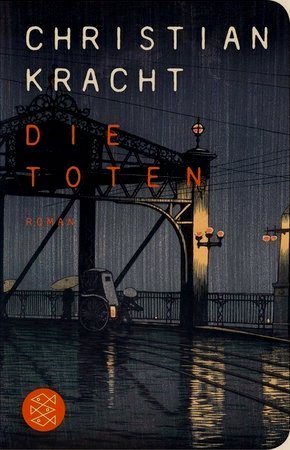 Im Gegenzug kann man jedoch gar nicht aufzählen, wie viele exquisite Sätze dieser hypnotische Roman enthält, ein Roman, der Thomas Manns betulich konstruierte Schachtelsätze mit der Cut-and-paste-Erzählweise und der Gewalt-Ästhetik Tarantinos verknüpft; der Nō-Theater, deutschen Expressionismus und L.A.-Noir zu einem sehr lesenswerten Literaturspaß collagiert. Aber Revolution des Romans? Ma gavte la nata!
Im Gegenzug kann man jedoch gar nicht aufzählen, wie viele exquisite Sätze dieser hypnotische Roman enthält, ein Roman, der Thomas Manns betulich konstruierte Schachtelsätze mit der Cut-and-paste-Erzählweise und der Gewalt-Ästhetik Tarantinos verknüpft; der Nō-Theater, deutschen Expressionismus und L.A.-Noir zu einem sehr lesenswerten Literaturspaß collagiert. Aber Revolution des Romans? Ma gavte la nata!
Doch bleiben wir dabei, was ich an Kracht selbst gewinnend finde: etwa die Ehe mit der vollkommen sympathischen Filmregisseurin Frauke Finsterwalder (wieder ein Name wie aus dem Krachtianischen Universum). Als kreatives Team sind die beiden auch ein großer Gewinn für den deutschen Film. 2022 soll das gemeinsame Projekt Sisi und ich fertiggestellt werden, welches die letzten Jahre der Kaiserin Elisabeth von Österreich (Susanne Wolff) aus Sicht der Hofdame Irma Sztáray (Sandra Hüller) neu erzählt.
Filmisch erzählen, das kann Christian Kracht. Für den gelernten Cineasten – er studierte in den USA Filmwissenschaften – findet sich eine adäquate Entsprechung in einem Statement des Regisseurs Wes Anderson über Jason Schwartzmans Schriftsteller-Figur in The Darjeeling Limited (2007): „Jasons Charakter nimmt sehr persönliche Erlebnisse aus seinem Leben und verwandelt sie in Fiktion. Dies ist seine Art, in seinem eigenen Leben ein neues Kapitel aufzuschlagen.“
Dann seine Freundschaft mit Eckhart Nickel, mit dem er gemeinsam einige neue Lebenskapitel aufschlug, die Dandy-Abenteuer Ferien für immer: Die angenehmsten Orte der Welt verfasste und die Gebrauchsanweisung für Kathmandu und Nepal – eine irreführende Frechheit für einen „Reiseführer“, aber ein komödiantisches Memoiren-Buch (erschienen 2009) über eine sehr spezielle Zeit in Nepal.
Und natürlich Der Freund, eine richtig anspruchsvolle Kulturzeitschrift, Krachts publizistische Mission in den Nullerjahren, angelehnt an das US-amerikanische Magazin The Believer („dedicated to the concept of the Inherent Good; highbrow but delightfully bizarre“). Acht Ausgaben wurden zwischen 2004 und 2006 in der Freak Street in Kathmandu produziert, bis der nepalesische Boden politisch zu heiß wurde und die Redaktion für die letzte Ausgabe ins Hotel Boheme nach San Francisco übersiedelt werden musste.
Zu den Autoren von Der Freund gehörten unter anderem Rem Koolhaas, Jonathan Safran Foer, Alain Robbe-Grillet, Julia Franck, Karlheinz Stockhausen, Ingo Niermann, Momus, Albert Ostermaier, Rafael Horzon, Rezzo Schlauch und Reinhold Messner. In Lizenz nachgedruckt wurden Erzählungen und Lyrik von Truman Capote bis Allen Ginsberg sowie Gedichte von zeitgenössischen nepalesischen Poetinnen und Poeten. Ausführliche Interviews wurden unter anderem mit „The Lord of Angst“ David Lynch, Sci-Fi-Autor Stanislaw Lem und LSD-Erfinder Albert Hofmann geführt.
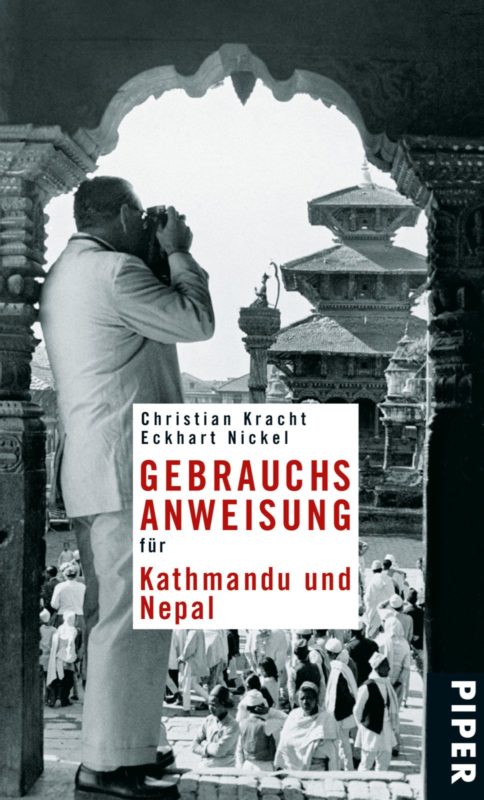
Nebenbei sammelten Herausgeber Kracht und Chefredakteur Nickel Bücher aus der Weltliteratur, die von Trekkern und Travelern in Nepals Hauptstadt zurückgelassen wurden und stellten so die Kathmandu Library zusammen, die 2016 im Literaturmuseum der Moderne in Marbach ausgestellt wurde.
„Papier ist das Schwerste, was man im Koffer oder Rucksack bei sich haben kann. Doch: Wer sich auf Reisen begibt und seine Lektüreerfahrungen dabei von Batterien und Bildschirmen abhängig macht, verlässt nie die Steckdosenzone. Nur mit richtigen Büchern aus Papier gelangt man bis ans Ende der Welt“, so Kracht und Nickel, oder Nickel und Kracht.
Nichts steht geschrieben
Auch das darf man an Christian Kracht hochhalten: sein Talent zur Freundschaft, sein Bedürfnis nach Gemeinschaft rund um die Sache, die ihm etwas bedeutet, gerade wenn es sich um eine Don-Quixoterie handelt. Ich finde anhand neuerer (und dabei ungewohnt eloquenter) Interviews, dass Kracht auch als Mensch gewachsen ist, nicht nur als Künstler: Niemanden Schwachen zurückzulassen, weil es das Naturgesetz so fordert, ist schließlich auch Kracht ein Anliegen und damit steht er diametral zu den grausamen Geboten der Steppe und des Neoliberalismus.
 Im einzigen Interview, das Kracht zum Erscheinen von Eurotrash Johanna Adorján für die Süddeutsche Zeitung gab, meint er, man könne das Schicksal und sogar das Vergangene verändern, wenn man es sich bewusst macht, und danach handeln, indem man das Dharma-Rad anhält und zurückdreht.
Im einzigen Interview, das Kracht zum Erscheinen von Eurotrash Johanna Adorján für die Süddeutsche Zeitung gab, meint er, man könne das Schicksal und sogar das Vergangene verändern, wenn man es sich bewusst macht, und danach handeln, indem man das Dharma-Rad anhält und zurückdreht.
Kracht: „Es gibt diese schöne Szene im Film Lawrence von Arabien, in der Omar Sharif, als ein Mitglied seiner Karawane nachts vom Kamel fällt und in der Wüste zurückgelassen wird, achselzuckend meint: „Es ist Allahs Wille. Es steht geschrieben.“ Und Peter O’Toole reitet in die inzwischen sengende Wüste zurück, um den Mann zu suchen und ruft Omar Sharif zu: „Nichts steht geschrieben!““
Dieser gereifte Kracht ist auch der (wiederum autofiktive!) Erzähler von Eurotrash, einem Graham-Greene-haften Buch, sozusagen Die Reisen mit meiner Mutter. Zum ersten Mal in Krachts Werk folgen wir einem Ich-Erzähler, den man nicht abzulehnen braucht, ja, an den man sich emotional anlehnen kann. Auch wenn dieser sich nach wie vor unzuverlässig erinnert, gerne mal flunkert und mit den Nerven am Ende ist.
Eurotrash ist trotz seiner bedrückenden Materie ein luftiges und lustiges Buch. So etwas muss man erst einmal hinkriegen. Innerhalb der Schweizer Gegenwartsliteratur verhält es sich wie eine Venus zu Fritz Zorns Mars – Kracht hat es seiner Frau, seiner Tochter, seiner Schwester und seiner Mutter gewidmet. Gespenstisch und fern im jenseitigen Faserland residiert Christian Kracht senior, fleißiger Zimmermann der Springer-Macht, der den einzigen Sohn angeblich „Philip“ gerufen hat. Ein Schicksal, das dieser mit Emil Nägeli aus Die Toten teilt.
Dann der irre Maso-Nazi-Opa mütterlicherseits, der nach dem Krieg, als Werbeprofi flott rehabilitiert, die Namen der Badeprodukte Duschdas und Badedas erfunden haben soll, mit denen sich eine ganze Wirtschaftswunder-Generation vom Grauen des Holocaust reinwaschen wollte. Das Resultat dieser familiären Erkundungen ist moralischer und tatsächlicher Abfall – Eurotrash: die Asche des Vaters in einer Plastiktüte, das bald wertlose Geld aus den Wertpapieren von Waffenherstellern in einer Plastiktüte, der Darminhalt der Mutter in einer Plastiktüte, die der Erzähler ständig zu wechseln gezwungen ist.
Die immer kluge Insa Wilke stellte zu Eurotrash fest, dass die Figur der Mutter ein Platzhalter ist für Krachts Leserschaft. Diese These erhärtet sich bei genauerem Hinsehen: Dauernd muss der Autor deren Stomabeutel ausleeren, muss sich anhören, dass er relevantere Bücher („wie Marcel Beyer“ oder „Knausgård, Houellebecq oder Ransmayr oder Kehlmann oder Sebald“) schreiben könnte. Sie beschwert sich über seinen kratzigen Öko-Wollpullover und dass ihm die Barbourjacke von früher so viel manierlicher angestanden wäre.
Die Mutter behauptet auch, Nabokov geküsst und Stendhal auf Französisch gelesen zu haben (obwohl sie sich nur die Fotos in der Bunten ansieht) und sie beschimpft ihren Sohn als dekadenten Huysmans, als Fabulierer und Egomonster mit den kalten, listigen Augen seines Vaters. Diese offenbar fiktionalisierte Version von Christian Krachts Mutter ist gewiss eine der scharfkantigsten Frauenfiguren der jüngeren deutschsprachigen Literatur, gerade weil sie in vielen Momenten so verletzlich und so ängstlich ist; etwa, wenn sie vor dem Besuch eines Restaurants zögert, denn sie wisse nicht mehr, „wie das geht“.
Auf der Suche nach dem Edelweiß auf dem Scex Rouge, hoch oben über Les Diablerets in den Schweizer Alpen, begegnen Mutter und Sohn den Hexen aus Macbeth („Auf, und durch die Nebelluft davon!“) in Form dreier indischer Damen, einem scheuen Fuchs und sie geraten in ein Schneegestöber. Da sind sie wieder, die typischen Topoi: Verwandlung, Verschlagenheit, Verschwinden.
Was letztendlich nicht verschwinden, sondern bleiben wird, ist der Stil, die schöne Sprache, das Kracht-Deutsch, welches in unsere Kultur Einlass gefunden hat.
Denn so wie es Bernhardeske Wendungen und Worte gibt (Krimsekt, Fleischwurst, Gummischuhe, Schottergrube, Watten, Kindervilla, Weinflaschenstöpselfabrikant, Ohrensessel, wie gesagt wird, vollkommen wahnsinnig, etc.), so haben sich auch Krachtianische Worte wie Tau an den Wänden des Bewusstseins niedergeschlagen: Neckarauen, Barbourjacke, Fiderallala, alrauniger Atem, sanftfüßig, Sonnenschein, Papierosy, Kokovore, Elfenstein.
Was ist abschließend zu Kracht zu sagen? Er ist einer der aufregendsten, smartesten und überraschendsten Schriftsteller seiner Zeit. Einer, der als Erzähler ein Kraftfeld aufzuspannen weiß. Kaum ein Satz von ihm ist langweilig. Alle seine Werke sind empfehlenswert, auch wenn sie nicht alle auf derselben künstlerischen Reiseflughöhe unterwegs sind.
Und er ist, so darf man doch von ihm denken, in letzter Konsequenz ein Guter. Das möchte man diesem scheuen Schelm gern leise zurufen: “Hey, Mr. Kracht! You’re one of the good ones, you know?”
Christian Kracht, indessen, ist schon längst wieder abgereist und weit, weit weg.
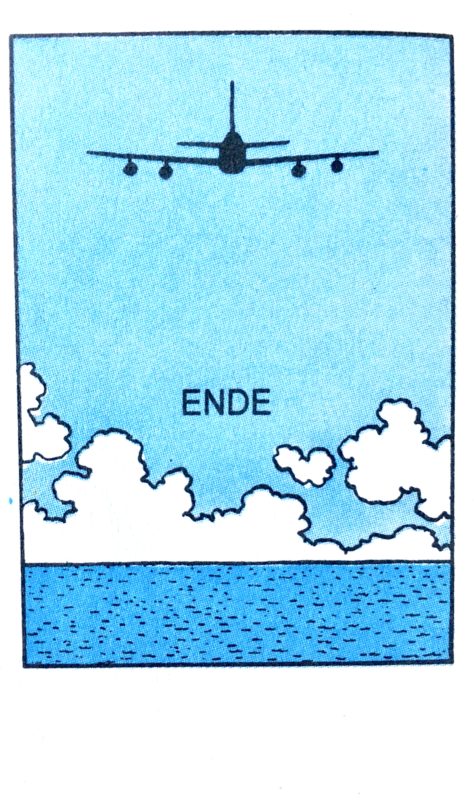
(Simon Schreyer, 2021)
*
Zum Weiterhören:
BR2 Nachtstudio Radio Essay: Christian Kracht ist nicht zu fassen – Der Autor und sein Double
Deutschlandfunk/Kultur: Wiebke Porombka im Gespräch mit Christian Kracht über Eurotrash